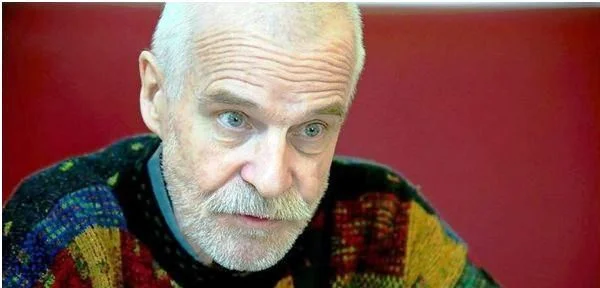
Im Hotel Pullman Al Shahba in Aleppo oder Halap, wie der arabische Name lautet, begann mein Abstieg in die finsteren Kerker Syriens, wo Beshar Assad seine Opponenten einzuquartieren pflegt. Zunächst hielt man mich in dem Hotel unter Hausarrest, weil ich ohne Visum eingereist war. Dort konnte ich immerhin noch in einem weichen Bett mit für meinen Geschmack viel zu vielen Kissen schlafen. Zudem wurde mir versichert, dass mein Verstoß gegen die syrischen Einreisevorschriften keine gravierenden Folgen haben werde.
Dann wurde ich gegen den Willen der Beamten vom Innenministerium, die mich im Hotel sozusagen betreut und bewacht hatten, in eine Polizeistation gebracht. Dort schlief ich auf einer Schaumstoffmatratze in einer sehr geräumigen Gefängniszelle, die sicherlich für 20 bis 30 Häftlinge angelegt, aber nur von einem harmlosen türkisch-kurdischen Zigarettenschmuggler belegt war, der laufend Patiencen legte und Tee kochte. Mehmet kannte sogar einen Trick, wie man Wasser in einer Plastikflasche mit Feuer erhitzen kann, ohne die Flasche zu zerstören.
Graffiti an den Wänden zeugte von einer internationalen Belegschaft, die der Zelle in der Vergangenheit einen Besuch abgestattet hatte: ein Alex aus der Ukraine hatte sich hier verewigt, ebenso der Repräsentant einer Patani-Befreiungsfront aus Thailand und sogar ein Mugabe, der aber vermutlich weder verwandt noch verschwägert war mit Zimbabwes Mugabe. Ein Berliner hatte seine Meinung über die syrischen Behörden offen kundgetan: „Hurensöhne“, Arschlöcher“.
Selbst die Polizisten wunderten sich
Dabei waren die Polizisten und Aufsichtsbeamten hier ganz nett. Sie versicherten mir wiederholte Male: „Little“, womit sie andeuten wollten, dass ich nach kurzem Aufenthalt wieder entlassen werde. Tatsächlich begannen sie schon einen Tag nach meiner Ankunft, die bürokratischen Hürden auf dem Weg zur Haftentlassung aus dem Weg zu räumen, und nach fünf oder sechs Tagen stand meine Entlassung kurz bevor. Doch plötzlich bewegte sich nichts mehr. Eine Woche verstrich, zwei Wochen verstrichen. Selbst die Polizisten wunderten sich über die Verzögerungen.
Also legte ich mit Mehmet Patiencen, trank seinen Tee, aß sein Brot und rauchte seine Zigaretten. Die populärsten unter den importierten Zigaretten waren die französischen Gauloises und Gitanes, die ich – aus der einstigen französischen Besatzungszone stammend – schon seit meiner Kindheit rauche. Im Gegenzug dafür machte ich ein paar Fotos von ihm und unserer Unterkunft, die ich inzwischen mit ein paar beruhigenden Worten seiner Frau in Kilis (Türkei) geschickt habe.
Abstieg in die Hölle
Eines Abends nach drei Wochen holten mich drei Polizisten in grünen Kampfanzügen und bewaffnet mit Pistolen und Kalaschnikows ab und brachten mich im Jeep ins Gefängnis der Sicherheitspolizei. Es war ein Abstieg in die Hölle, wie mir schien. Hier lagen die Häftlinge dicht gedrängt in überbelegten Gefängniszellen. Das Bild erinnerte mich an die alten Darstellungen von Sklavenschiffen, wo die Afrikaner wie Ölsardinen in der Büchse dicht an dicht aneinander gekettet waren. Ich wurde zunächst in eine Vier-Mann-Zelle eingewiesen, die schon von fünf Mann belegt war. Nach wenigen Tagen aber wurde ich in eine Zelle ohne Beleuchtung und Lüftung verlegt, wo ich die nächsten fünf Monate in weitgehender Isolation verbringen sollte.
In diesem Gefängnis dominierten ganz eindeutig Adidas oder die gefälschten Trainingshosen und -jacken von Adibas und Abidas die Gefängniskleidung. Andere Marken konnten sich auf diesem Markt offenbar nicht durchsetzen und tauchten nur gelegentlich in sehr geringem Umfang auf. Nur der stimmgewaltige Abu Hassan, einer unserer Wärter, kam jeden Tag mit einem anderen Blouson von Nike. Alle, auch die Häftlinge trugen überwiegend Sportkleidung aus dem weltbekannten Modehaus in Herzogenaurach.
Fünf Monate lange nur mit einer Unterhose
Alle 14 Tage bis drei Wochen wurde solche Sportkleidung von der Gefängnisverwaltung verteilt, und anschließend stolzierten die Häftlinge in ihren neuen T-Shirts, Hosen oder Jacken wie auf einer Modeschau durch die Korridore. Nur ich erhielt auch in Bezug auf die Bekleidung eine Sonderbehandlung, ich erhielt nie etwas, keine schicke Hose, kein schickes T-Shirt mit den drei Streifen. Mir gaben die Gefängnisaufseher überhaupt keine Kleidung. So lag ich beinahe fünf Monate lang nur mit einer Unterhose spärlich bekleidet in meiner dunklen Zelle, was allerdings auch nur von geringer Bedeutung war, da ja eh niemand präsent war, meinen teuren Geschmack bewundern zu können. Erst gegen Ende meiner Haftzeit schenkte mir ein Mithäftling eine seiner Hosen, allerdings nicht der Marke Adidas sondern „New Look“, wovon ich noch nie gehört hatte.
Die Hitze in meiner Zelle wurde unerträglich. Bei einer der wenigen Gelegenheiten, in denen ich sie verlassen durfte, hatte ich in einer zuvor geräumten, leeren Zelle einen Eimer gefunden und beschlagnahmt. So überschüttete ich mich laufend mit Leitungswasser. Mein Wasserverbrauch war immens, weshalb ich tatsächlich ein schlechtes Gewissen hatte. In einem trockenen Land wie Syrien mit seinen Wüsten war Wasser sicherlich ein wertvolles Gut. Die Strafe für mein frevelhaftes Handeln folgte denn auch bald. Meine Hände waren feuerrot und brannten auch wie Feuer.
Die Spritze hätte ein Pferd umgeworfen
„Wasserallergie“, diagnostizierte der Anstaltsarzt, dem drei Sanitäter assistierten. Ich traute „Viktor“, wie er gerufen wurde, nie. Er schien nur die im Gefängnis am häufigsten vorkommenden Krankheiten zu kennen. Folgerichtig standen ihm auch nur ein Dutzend Medikamente zur Behandlung der Insassen zur Verfügung. Besonders berüchtigt war eine Spritze, die er allen Gefangenen regelmäßig ins Gesäß stieß. Die Spritze hätte ein Pferd umgeworfen, und so rieben sich die Gespritzten mit schmerzverzerrten Gesichtern den Hintern und rannten die Korridore auf und ab. Angeblich sollte sie Erkrankungen der Atemwege verhindern. Als ich einmal einen Hautausschlag hatte und ihn rief, gab er freimütig zu, nicht zu wissen, wie er die rötlichen Pickel behandeln sollte. Also verzichtete er einfach auf jede Art von Behandlung.
Immerhin brachte mir die „Wasserallergie“ Zellenurlaub ein: Ich durfte zwei Wochen außerhalb der Zelle auf dem Korridor sitzen und schlafen. Das brachte weitere Vorteile: Bei der Essensverteilung konnte ich gelegentlich ein Extra-Brot oder in seltenen Fällen sogar ein paar Oliven für mich oder meine nächsten Zellennachbarn organisieren. Das wiederum steigerte meine Popularität unter den Mithäftlingen. „Almani“, riefen sie mich und boten mir Zigaretten an. Die Putzkolonnen im Korridor dienten als Kuriere. Seife, Brot, gelegentlich sogar ein Keks oder ein Stückchen Schokolade wurden mir fortan durch das Gitterfenster zugeschoben.
Geprügelt und geschrien
Ein junger Mann, der „orientalische Architektur“ studiert hatte, wegen Teilnahme an einer Demonstration gegen den Alawiten im Präsidentenpalast einsaß und im Gefängnisalltag bei der Essensverteilung eingesetzt war, ließ mir im muslimischen Fastenmonat Ramadan eine köstlich süße Dattel zukommen. Es war die größte Delikatesse, die ich in den fünf Monaten meiner Haftzeit genoss. Abud, wie er hieß, träumte davon, einmal einige Zeit in einem deutschen Architekturbüro arbeiten und westliche Architektur lernen zu können.
Auf dem Korridor erfuhr ich auch endlich, warum Mithäftlinge so viel schrien und ständig vor dem Gitterfenster meiner schweren Zellentüre auf und ab rannten. Ich hatte schon lange den Verdacht gehegt, dass sie gefoltert wurden. Tatsächlich wurde hier viel geprügelt und geschrien. Die Aufseher waren offenbar außerstande, in normaler Lautstärke zu reden, sondern brüllten nur. Die Geprügelten schrien. Für die Prügelorgien gab es eine spezielle Vorrichtung, auf denen sie beinahe regelmäßig mit in die Höhe gereckten Füßen festgeschnallt wurden. Und dann gab‘s mächtig was auf die Sohlen. Anschließend wurden sie von den Aufsehern mit Stockhieben die Korridore auf und ab gejagt, so dass die Füße nicht zu dick anschwollen. Trotzdem sah ich gelegentlich Häftlinge, die auf Knien und Händen durch den Korridor rutschten. Ihre Füße waren auf das Doppelte ihrer Größe angeschwollen.
Geprügelt bis er seine "Verbrechen" zugibt
Manche Gefängnisinsassen freuten sich auf diese Stockhiebe, weil sie oft die Entlassungsrituale einleiteten. Gegen Ende meiner Haftzeit schoben die Aufseher diese Häftlinge beinahe regelmäßig in meine Zelle. Dann saßen oder lagen sie neben mir, zeigten mir ihre gepeinigten Füße und warteten gut gelaunt auf die nächste Runde. Sie standen wirklich kurz vor ihrer Entlassung, wie ich feststellte.
Es waren nicht nur Aufseher, die ihre sadistischen Triebe an den Gefangenen auslebten, sondern auch die reichlich mittelalterlich operierenden Ermittler, die Häftlinge quälten. Anders als in zivilisierteren Ländern gibt es in Syrien offenbar kein Aussageverweigerungsrecht. Also wird der Angeklagte so lange geprügelt, bis er all seine Sünden, Verbrechen und Vergehen zugibt. Meine Hinweise auf TV-Serien wie „CSI Miami“, “CSI New York“ oder „Crossing Jordan“, wo sie moderne Ermittlungsmethoden lernen könnten, stießen auf taube Ohren.
"Hang down your head, Tom Dooley"
Meine energisch vorgetragenen Hinweise auf internationale Gesetze und UN-Menschenrechtskonventionen beeindruckten weder die Aufseher noch deren Opfer. „Die Vereinten Nationen gibt es hier nicht“, erklärten sie mir jedes Mal. Mein Einwand, als Mitglied der UNO müsste Syrien diese Menschenrechtskonventionen automatisch unterschrieben haben, stieß nur auf verwundertes Lächeln. Der Almani hatte einfach keine Ahnung von nahöstlichen Gepflogenheiten: „Hier gibt es keine Vereinten Nationen.“
Auch bei den Mithäftlingen stieß ich mit meinem Vorschlag, gemeinsam den Chor der Gefangenen aus Verdis Oper Nabucco „Va, pensiero, sull'ali dorate“ zu singen, nur auf Unverständnis. Umsonst bemühte ich mich, ihnen wenigstens die Melodie beizubringen, so dass sie meinen Gesang summend hätten begleiten können. Erst als ich sie aufforderte, mir Lieder der legendären Oum Khalsoum oder der phantastischen Fairuz vorzusingen, begannen sie, meinem Beispiel zu folgen und zu singen. Ich blieb aber der größte Sänger in Aleppo. Ich sang alles, was mir einfiel, und mir fielen sogar die Texte von Liedern ein, die zu kennen ich vorher gar nicht gewusst hatte: von „Sah ein Knab‘ ein Röslein stehn“ über „Lili Marleen“ oder „Hang Down Your Head, Tom Dooley“ bis zum „Wolgalied“ oder „Scharnhorstlied“, das ich einst als Rekrut bei der Bundeswehr gesungen habe: „Ein mächtiger Schatten jagt über die See/ des nachtdunklen Nordmeers in eisiger Bö./ Dumpf rauschen die Brecher um Brücke und Turm/ Vorüber, verschwunden in Dunkel und Sturm.“
"Almani, anziehen!"
Eines Morgens - ich hatte mich an drei oder vier Stellen bereits wundgelegen, wogegen auch kein Wenden half – wurde ich unsanft geweckt. „Almani, anziehen“, rief einer der Aufseher durch das Gitterfenster meiner Zellentür. Kurz darauf öffnete ein weiterer die Tür – und schloss sie auch nicht mehr ab. Nach stundenlangem Warten wurde ich in einer mehrere Stunden dauernden Autofahrt zum Flughafen von Aleppo gebracht, wo ich gemeinsam mit vier Begleitern bis spät in die Nacht auf eine Maschine nach Damaskus wartete.
Dort wurde ich in das Haftzentrum der Einwanderungsbehörde gebracht, wo mir die Aufseher schon bei meiner Ankunft versicherten, hier sei es gemütlicher. Es war tatsächlich gemütlicher. Zwar nahm man mir wieder Laptop, Kamera, Mobile Phone und alles Bargeld ab, doch ich konnte nun in einem Saal mit einem Dutzend weiterer Häftlinge den Schlaf auf einer weichen Schaumstoffmatratze genießen. Es wurde nicht geprügelt und nicht gebrüllt, wie in Aleppo.
Man nahm mir die Handschellen ab
Hier beklauten die Aufseher von der Polizei ihre Gefangenen. Hier konnten die Häftlinge, die über syrische Lira verfügten, Tomaten, Zwiebeln, Pommes frites, Nescafé, Teebeutel, Schokolade, Zigaretten, Obstsäfte, Limonaden und andere Delikatessen einkaufen, liefen aber beständig Gefahr, einen Teil der erworbenen Köstlichkeiten den Aufsehern geben zu müssen. Einer mit Namen Muhsin fiel dabei besonders auf. Ich weigerte mich, ihm ein Geschenk zu machen, wie er gefordert hatte. Dafür wandte er sich an einen andern Häftling, von dem er verlangte, ihm die Dose Humus, die dieser gerade gekauft hatte, zu geben. Zufrieden trollte sich Muhsin mit der köstlichen Sesampaste.
Meine Mitgefangenen versicherten mir, dass ich nun ganz sicher bald nach Haus käme. „Eine Woche, zehn Tage“, dann würde ich bestimmt nach Hause geschickt. Und tatsächlich, nach zehn, im Vergleich zu meiner Zeit in Aleppo beinahe gemütlichen Tagen riefen mich die Aufseher und schickten mich auf eine mehrstündige Autofahrt durch Damaskus. Als ich gerade begann, mir Sorgen zu machen, weil ich befürchtete, es ginge erneut in ein Gefängnis, hielt der Wagen. Man nahm mir die Handschellen ab und führte mich in einem Raum, auf dessen Tisch Tee, Kaffee und Joghurt standen. „Bedienen Sie sich“, wurde ich aufgefordert. „Wir warten hier auf ein paar Freunde.“
„Deutsche Freunde“, fragte ich hoffnungsvoll. „Hm, Sie werden sehen.“ Schließlich brachten sie mich in einen Saal, wo ich endlich wieder deutsch hörte. Es ging mir wie Heinrich Heine bei seiner Rückkehr aus dem Pariser Exil: „Und als ich die deutsche Sprache vernahm,/ Da ward mir seltsam zumute;/Ich meinte nicht anders, als ob mir das Herz/ Recht angenehm verblute.“