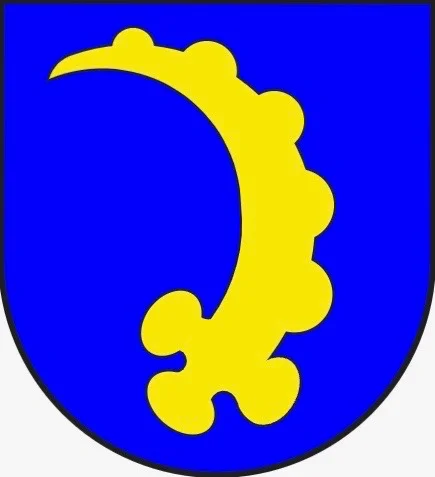Kennen Sie Pagig? – Ich meine nicht Pany oberhalb von Küblis im Prättigau. Pagig ist ein kleines Dorf im Schanfigg, dem südlichen Nachbartal des Prättigaus. Wer je mit dem Auto oder der Bahn nach Arosa gefahren ist, erinnert sich an die unzähligen Kurven entlang des Nordhangs des tief eingeschnittenen Tals der Plessur.
Die Bahn sucht sich bis Langwies unten in der Schlucht ihren Weg. Die Haltestellen mit ihren putzigen Stationsgebäuden erinnern zwar mit ihren Namen (Lüen-Castiel, St. Peter-Molins, Peist) an die Schanfigger Dörfer, aber es ist die nicht weniger kurvige Strasse weiter oben am Hang, welche seit jeher die alten Walserdörfer mit Chur und der weiten Welt verbindet.
In den späten 1950er Jahren haben meine Eltern ihre Kinderschar jeweils im Sommer nach Arosa zum Wandern disloziert. Auf der Fahrt im alten Vauxhall gab es damals regelmässige Notstops, weil immer jemandem schlecht wurde. An diese Aufregungen, aber auch an den hohen Kirchturm von St. Peter oder das elegante Bahnviadukt bei Langwies, erinnere ich mich bis heute, aber das Dörfchen Pagig war damals meiner Aufmerksamkeit entgangen. Ganz anders war das in Graubündens Hauptstadt, erzählte mir kürzlich Manuela, welche in Chur zur Schule gegangen ist. Wollte man jemandem zu verstehen geben, er oder sie sei nicht ganz richtig im Kopf, hätte man gefragt: «Kunsch vo Pagig?» Welchem Umstand Pagig diesen besonderen Ruf zu verdanken hat, kann mir allerdings bislang niemand erklären.
Das kleine, auf etwa 1300 m ü. Meer gelegene Dörfchen hatte anno 2008, als es mit der Nachbargemeinde St. Peter fusionierte, gerade einmal 63 Einwohner. Auch während der zwei Jahrhunderte zuvor hat die Zahl nie die Hundert überschritten. Die Zweckehe St. Peter-Pagig überlebte übrigens nur gerade fünf Jahre. Anfang 2013 schluckte Arosa alle Schanfigger Gemeinden auf der rechten Talseite, ausser Maladers, das sich nach Chur «rettete».
Während Jahrzehnten hatte das Tal mit seiner kurvenreichen Strasse in meinem Leben kaum mehr eine Rolle gespielt – bis vor einem Jahr, als ein mehrere hundert Jahre altes Walserhaus sozusagen ins Leben meines Sohnes trat und sich dadurch auch seine Partnerin, die einstige Churer Schülerin, mit dem «Undorf» anzufreunden begann.
Bekanntlich schmelzen Vorurteile immer dann am leichtesten, wenn man ihr Objekt genauer anschaut. Als ich erstmals wieder den in der Altstadt gut versteckten Anfang der Schanfigger Strasse gefunden und die ersten Kehren oberhalb von Chur, wo man nicht unbedingt dem Postauto begegnen möchte, hinter mir gelassen hatte, fand ich die Strasse weit weniger schlimm als in meiner Erinnerung. Zugegeben, sie ist unterdessen durch den Bau mehrerer Tunnels und kühner Brücken an manchen Stellen signifikant gestreckt worden, aber abenteuerlich und abwechslungsreich ist sie noch immer mit den grandiosen Ausblicken ins Rheintal.
Übrigens schmelzen im Schanfigg nicht nur Vorurteile rasch; das gilt auch für den Schnee, besonders am Südhang in einem Winter wie dem diesjährigen, der Lagen unterhalb von 1400 Meter sträflich vernachlässigt hat. Wie kürzlich einer Übersicht über die Auswirkungen der Klimaveränderung auf Schweizer Wintersportzentren zu entnehmen war, gehört das Skigebiet Fatschél-Hochwang oberhalb von St. Peter zu den akut gefährdeten. Wegen Schneemangels und finanzieller Probleme stehen die Bahnen schon seit einiger Zeit still. Für den Winter 2024/25 soll nun eine neue Finanzierung in Angriff genommen werden.
Des einen Leid ist des andern Freud – die alte Weisheit ist mir in den Sinn gekommen, als ich kürzlich über ein Wochenende in Pagig zu Gast war und am Sonntag vor dem Frühstück die Gegend erkundete. Es ist erst Mitte März, doch bis über 1600 Meter Höhe hinauf findet sich am Südhang kaum noch ein Fleckchen Schnee. Dafür blühen Krokusse zwischen der frischen Losung der Rehe. Auf dieser Talseite muss der Winter für das Wild für einmal ziemlich entspannt gewesen sein. Ganz anders gegenüber: Noch reicht der Schnee bis nach Tschiertschen hinunter, was für den dortigen Skilift von Vorteil sein dürfte. Auch an der Nordflanke des Aroser Weisshorns scheint der Winter noch lange nicht vorbei.
Jahreszeitlich zweigeteilt kommt mir die Welt vor, als ich von Pagig, wo alles noch schläft, ostwärts der Sonne entgegen gehe und den Hang und den obersten Teil des Pardieler Tobels quere. Dort finde ich dann doch noch zwei letzte klägliche Schneerestchen. Ob dem Gitzistei – was für ein wunderbarer Name! – liegen frisch gefällte Föhren am Weg. Durch den lichten Bergwald scheint die Morgensonne.
Ich denke an die sechzig Pagiger und an ihre Vorfahren, welche bis vor 16 Jahren für eine unabhängige Gemeinde verantwortlich gewesen waren, ich denke an die mehr als 500 Hektaren Land, davon über 90% land- oder forstwirtschaftlich nutzbar, welche sich von der Plessur (820 m ü. M.) bis zum Hauptgipfel des Hochwangs (2533 m ü. M.) erstrecken. Ich denke an die zähen Walser, welche Ende des 13. und Anfang des 14. Jahrhunderts aus der Landschaft Davos und dem Prättigau von den Passübergängen her – wie sie es als Siedler vom Wallis bis ins Vorarlbergische immer gemacht haben – ins Schanfigg eingewandert sind und sowohl die Sprache der ursprünglich rätischen Bevölkerung verdrängt als auch mit ihren aus Holz gebauten Häusern und Ställen neue Siedlungen geschaffen haben. Ab dem 15. Jahrhundert war dann das einstige rätische Schanfigg mehrheitlich Deutsch sprechend. Von dort setzte sich auch im Unterland, von Chur bis hinunter nach Walenstadt, Schweizerdeutsch gegenüber dem Rätoromanischen immer mehr durch, bis letzteres schliesslich ganz verschwand.
Irgendwo hier muss ich die einstige Gemeindegrenze zwischen Pagig und St. Peter überschritten haben. Ich trete hinaus auf eine offene Weide. Einzelne Bäume haben hier dem Schnee und den Lawinen getrotzt, auch ein Heustadel, der dunkel am Horizont steht. Beim Punkt 1468 trennen sich die Wege: Der linke führt weiter zum einstigen Maiensäss Fatschél, das unterdessen zum ganzjährig bewohnten Tourismuszentrum der Region geworden ist, der rechte führt hinunter nach Bofel, wo zwischen 1995 und 2010 sozsagen auf der grünen Alpwiese eine Ferienhaussiedlung entstanden ist, welche dank architektonischer Vorgaben und mit etwas gutem Willen noch immer als eine Siedlung der Walser durchgehen könnte – wenigstens von der andern Talseite aus betrachtet.
Eigentlich würde es mich bei der Weggabelung nach links ziehen, hinauf zum Schanfigger Höhenweg, aber dafür bin ich heute morgen nicht ausgerüstet. Und zudem wartet in Pagig ein Morgenessen auf mich. So siegen die Vernunft und der Vorsatz, meine Erkundigungstour ein nächstes Mal hier fortzusetzen.
Der Rückweg ist prosaischer. Unterhalb Bofel kann man auf einem alten Alpweg einige Kurven der Fatschelerstrasse abschneiden. Auf dem letzten Stück bis zur Staatsstrasse Chur–Arosa bleibt einem der Asphalt allerdings doch nicht erspart. Zum Glück gibt es am Sonntagmorgen kaum Verkehr. Und zudem fühlt man sich als Wanderer angezogen vom massiven und doch schlank wirkenden Turm der Kirche St.Peter. Er ist im 11. oder 12. Jahrhundert als Wehrturm gebaut worden, doch schon viel früher wurde St. Peter das kirchliche Zentrum der ganzen Talschaft. Erstmals wird die Kirche um das Jahr 840 erwähnt. Der Turm ist einer der wenigen Zeugen aus jener Zeit, als das Schanfigg romanisch war.
Bei der Einmündung in die Staatsstrasse nach Arosa, welche von einem Steinbock in kämpferischer Pose bewacht wird, hält eben das Postauto aus Chur. Die Linie 41 nach Peist bietet die beste ÖV-Verbindung nach Pagig. Man steigt entweder an der Haltestelle «Pagig Tura» aus und steigt auf der alten «Gassa», welche heute für Fahrzeuge gesperrt ist, über den Grat die rund 70 Höhenmeter nach Pagig hinauf. Oder man fährt noch zwei Stationen weiter zur Haltestelle «Pagig Abzweigung», wo ich jetzt vor dem grimmigen Steinbock stehe, und wandert auf der Fahrstrasse – asphaltiert, gleichmässige Steigung – zum Dorf. Hier finden meine Füsse den Weg allein, und ich kann in Gedanken nochmals zu den Walsern zurückkehren, welche eines Tages mit ihren Familien und Tieren von Davos über den Strelapass ins Schanfigg gekommen waren – oder aus dem Prättigau und den Fideriser Heubergen über die Arflina Furgga. Was haben wohl damals die Rätoromanen dazu gesagt? Waren für sie die Walser feindliche Einwanderer und Asyl suchende Profiteure, oder waren sie willkommene Arbeitskräfte, die halfen, das Land besser zu nutzen? Auf jeden Fall waren die Einwanderer sprachlich und kulturell sehr verschieden und, wie die Geschichte zeigt, für die Sprache der Romanen eine echte Bedrohung.
Was hiesse das für unsere heutige Zeit, wenn wir diese Geschichte zu Ende denken? – Vielleicht täte es uns gut, uns hie und da nüchtern daran zu erinnern, dass in unseren Landen – und überall auf dieser Welt – immer gewandert worden ist – eingewandert und ausgewandert –, und dass Kulturen nicht unbedingt untergehen, wenn sie sich im Austausch mit andern verändern oder gar weiterentwickeln …
Aber jetzt wird gefrühstückt.