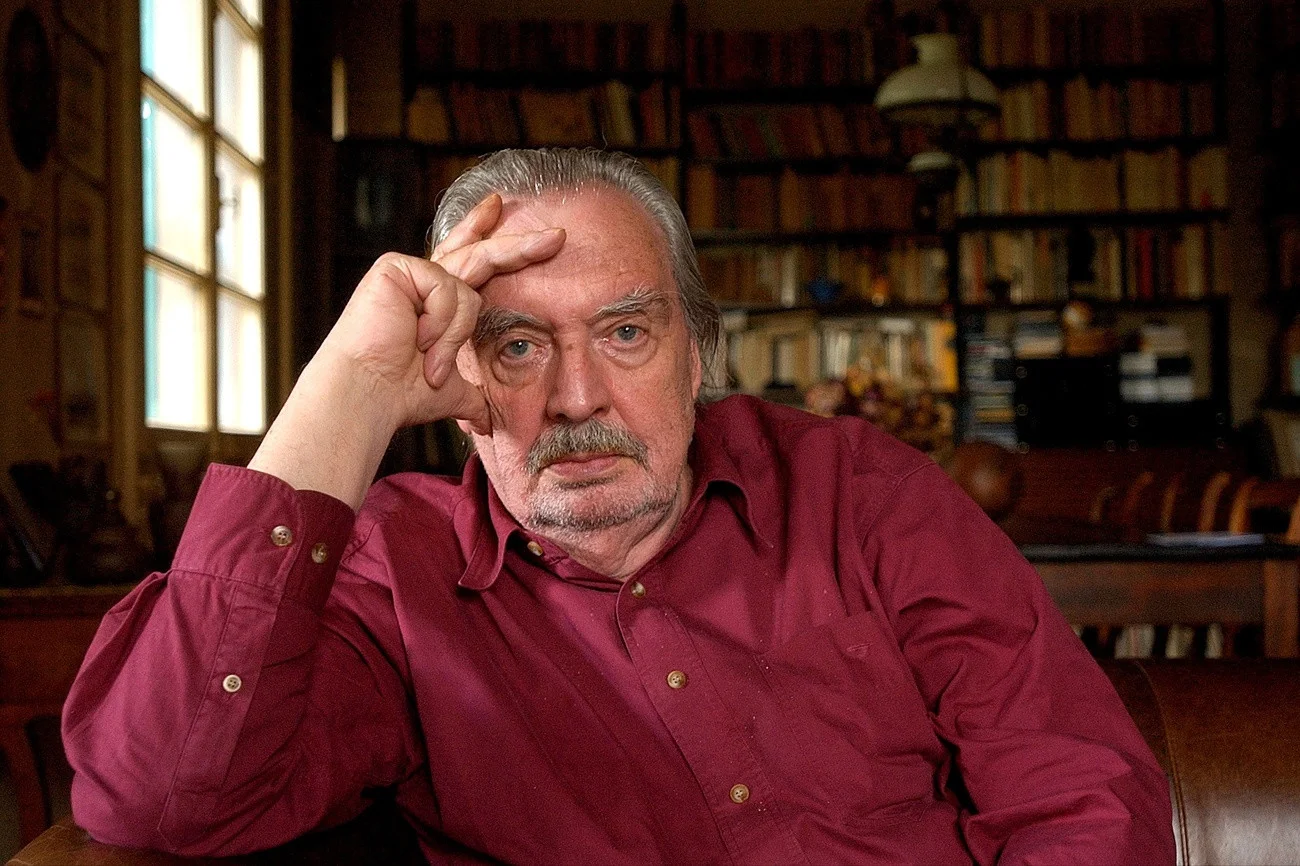Am Sonntag, 11. September, ist in Genf der Filmregisseur Alain Tanner im Alter von 92 Jahren gestorben. Neben zahlreichen kürzeren Arbeiten hat er im Verlauf von gut drei Jahrzehnten zwanzig Kinofilme realisiert und damit den Neuen Schweizer Film bedeutend geprägt.
Am Anfang litten seine Figuren noch mit Witz und Optimismus an der Schweiz. Dann aber zunehmend griesgrämig, verdrossen ob all der kapitalistischen Misere. Trotzdem hat der Genfer Alain Tanner ein für den Schweizer Film höchst bedeutsames Œuvre hinterlassen.
Tanner, Soutter, Goretta. So lautete, und in dieser Reihenfolge, während Jahren die Heilige Trinität des Schweizer Films (Michel Soutter, der um ein paar Jahre jüngere der beiden fast gleichaltrigen Kollegen, ist bereits 1991 gestorben, Claude Goretta 2019). Die drei waren auch die klangvollen Namen innerhalb des Groupe 5, einer 1968 gebildeten Interessengemeinschaft von Genfer Regisseuren, zu der noch Jean-Louis Roy und Jean-Jacques Lagrange/Yves Yersin zählten. Zwischen 1969 und 1973 realisierten sie in rascher Folge acht Filme, die nicht nur das cinephile Schweizer Publikum elektrisierten, sondern auch und besonders in Paris Aufmerksamkeit generierten.
Gestus der Verweigerung
Es war Alain Tanner, der 1969 mit «Charles mort ou vif» den Auftakt machte. Einem Film, der ebenso durch seine «improvisierende» Inszenierung, die atonale Musik (prägnante Kompositionen sollten ein Erkennungszeichen von Tanners Filmen bleiben) als Paukenschlag im – fast gänzlich zum Erliegen gekommenen – Schweizer Film empfunden wurde, wie auch durch sein Thema.
Diese «petite fresque historique» erschloss der Figur des Unangepassten, die der ältere Schweizer Film als «Sonderling» kannte, in der Person des Protagonisten neue Bereiche. Zugleich musste mit einem Minimum ausgekommen werden. Das Budget von 120’000 Franken war auch für damalige Verhältnisse winzig; Löhne konnten praktisch keine gezahlt werden.
Hier ist der «Aussteiger» ein Unternehmer, Besitzer einer kleinen Uhrenfabrik, dessen Grossvater «ein alter Anarchist aus dem Jura» war und der nun den Geist des Widerspruchs verkörpert – eines sanften Protests freilich, wie ihn François Simon so unnachahmlich zu verkörpern wusste. Weshalb er denn eine Brille getragen habe, wenn er doch keine brauche, fragt sein das Geschäftliche regelnder Sohn diesen Charles Dée und erhält eine der Antworten, die damals die intellektuelle junge Schweiz in Verzückung versetzten: «Damit ich weniger klar sehe.» Auch heute noch witzig ist die Szene am Mittagstisch, wo die Nachrichten beiläufig die Annahme des Frauenstimmrechts in der Schweiz vermelden (die zwei Jahre später, 1971, dann ja auch Tatsache werden sollte).
Mit solchen Einfällen schuf sich Alain Tanner alsbald den Ruf, wo nicht eines Propheten, so doch eines «Seismografen», der die gesellschaftlichen Erschütterungen der Schweiz früher als andere wahrzunehmen und zu deuten imstande sei. Ich habe ihn beziehungsweise sein Werk einmal scherzhaft als Pierre du Niton des Schweizer Films bezeichnet, jenen Vermessungspunkt im Genfer See also, der sämtlichen Höhenangaben in der Schweiz zugrundeliegt. Massstab und Referenzpunkt ist es denn auch lang gewesen, lang über seine künstlerisch-ideelle Erheblichkeit hinaus.
Dokumentarische Anfänge
Alain Tanner war filmisch keineswegs aus dem Nichts gekommen, als er seinen ersten Spielfilm vorlegte. Am 6. Dezember 1929 in Genf geboren, hatte er an der Universität sowohl ein «diplôme de l’Administration maritime» erworben wie auch mit Claude Goretta zusammen den dortigen Filmklub gegründet. 1955 siedelten die beiden nach London über, wo sie im Rahmen einer Hospitanz am British Film Institute Untertitelungen, Übersetzungen und Archivarbeiten übernehmen konnten. Zusammen drehten sie 1957 «Nice Time», ihren zwanzigminütigen dokumentarischen Erstling über die Stimmung am nächtlichen Piccadilly Circus, der im selben Jahr in Venedig ausgezeichnet wurde.
Nachdem er bei der BBC ins Metier eingeführt worden war, realisierte Tanner erst in Paris, dann zurück in Genf im Lauf der sechziger Jahre fürs Westschweizer Fernsehen nebst Dutzenden von Kurzbeiträgen auch Filme, mit denen er sich bereits einen Namen schuf, wie «Ramuz, passage d’un poète» (1961), «L’école» (1962), «Les Apprentis» (1964), «Une ville à Chandigarh» (1966) oder «Docteur B., médecin de campagne» (1968). 1962 hatte er zu den Gründungsmitgliedern des Verbands Schweizerischer Filmgestalter gehört.
Tanners Ruhm haben die ersten fünf Jahre seines Spielfilmschaffens begründet; die ersten zehn – bis 1979, das Jahr von «Messidor» – erweiterten und konsolidierten das Bild, auf das er schliesslich festgelegt war. Alles, was danach noch kam an Spielfilmen, immerhin ein volles Dutzend, bot trotz gelungenen Momenten im Einzelnen nur mehr das Schauspiel der Ratlosigkeit eines Künstlers, wovon zumal die Remakes eigener Stoffe kündeten.
Und wenig half diesen Fortsetzungen, dass sie mit Esprit eingefädelt sein konnten: So war aufmerksamen Betrachtern seinerzeit schon aufgefallen, dass am Ende von «La Salamandre» (1971) das Wort «Fin» fehlte – es wurde Jahre später nachgeliefert in «Fourbi» (1995), der über einen wenig einfallsreichen Aufguss jedoch nicht hinauskam. Das Zitat, Lieblingsstilmittel Tanners – das er, in Reverenz an die Nouvelle vague, gern im «Brechtschen» Gestus der Verfremdung vortrug, zumal demjenigen des demonstrativen Lektürevortrags, war nun zum bemühenden Zitat seiner selbst verkommen. Und «Jonas et Lila, à demain» (1999), die termingemässe Wiederaufnahme von «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» (1976), vertröstete – angesichts der deprimierenden Einsicht, dass sich die Zeitläufte anders als gedacht entwickelt hatten (es waren keine «streikenden Arbeiter in Genf niedergeschossen» worden) – halt weiter auf ein gelobtes «Morgen». So sass der Filmemacher trotzig in seiner marxistisch möblierten Sackgasse, einer Zeit entfremdet, die nicht mehr die seine war.
Fremder im eigenen Land
Doch war Alain Tanner nicht immer schon ein Fremder in diesem Land gewesen? Ostentativ setzt «Messidor» mit «Gute Nacht» aus Schuberts «Winterreise» ein: «Fremd bin ich eingezogen/Fremd zieh ich wieder aus», um mit «Nun ist die Welt so trübe» zu enden, betont dann der Refrain: «Fein Liebchen, gute Nacht!» Er habe keine «Wurzeln», «pas de véritable identité», schrieb Tanner in seinen «Ciné-mélanges» (2007). Seine Eltern hätten zwar in Genf gewohnt, aber kaum gewusst, wo sich die Schweiz befinde. In dieser Hinsicht sei er eine Waise gewesen, abgesetzt auf der Grenze irgendwo zwischen der Schweiz und Frankreich. «No Man’s Land» (1985) bezeichnete einen solchen Nichtort, frequentiert von einigen Heimatlosen, endend in der (forcierten) Erschiessung eines Schmugglers; in etwas variierter Form, nun erweitert um den autobiografischen Aspekt des Regisseurs, dem die Themen abhandengekommen sind, griff «La Vallée fantôme» (1987) das Sujet nochmals auf.
Im Jahr vor der Aufnahme der Arbeit an «Messidor» hatte Tanner zur Sendereihe «Ecoutez voir» der TSR den halbstündigen «Temps mort» (1977) beigesteuert, eine Reflexion über den Ort von Bild und Film in unserer Gesellschaft. «Das Kino hat sich erschöpft», notierte er sich dazu, «es ist besessen vom ‚Realen‘, um seine Lügen besser zu verbreiten. Die Ideologie des Sichtbaren, das blinde Vertrauen ins Sichtbare – um was zu sehen? Alles ist bereits gefilmt, gesehen, verdaut.» Geduldig zu zerstören, dies sei heute Teil der Arbeit.
«Messidor» unternahm dann zwar nicht die Zerstörung des Bilds an sich – vielmehr ist es eine optisch immer wieder opulente Tour de Suisse –, wohl aber diejenige des (Selbst-)Bilds eines Landes, dessen landschaftliche Schönheiten zur Kulisse einer verzweifelt-absurden Flucht zweier junger Frauen werden. Ihrerseits etwas absurd war wiederum die Empörung wegen des kaum zu sehenden nackten Hinterns der einen, die sich auf einer Alpweide hinkauert. Keine Frage war allerdings, dass die in «Jonas» mit Witz gezeigten Aporien eines alternativen Gesellschaftsmodells nun einem Ingrimm Platz gemacht hatten, der künftig ohne jeden Witz auskommen sollte.
Abschied von der Schweiz
Gross war die Aufregung, als Alain Tanner 1980 ankündigte, mit «Light Years Away» einen Film ausserhalb der Schweiz drehen zu wollen. Hatte die Schweiz nun also als Thema ausgedient, hatte sie ihm – und damit er ihr – nichts mehr zu sagen? Wie sich erweisen sollte, markierten die achtziger Jahre tatsächlich den Übergang ins «Internationale», oft Beliebige, manchmal auch Belanglose. Trat die Schweiz doch noch einmal in Erscheinung, dann in tendenziöser Verzerrung wie in «La femme de Rose Hill» (1989), der Geschichte der schönen Ausländerin im fremden Land (von Hugues Ryffel in bestechende Bilder gefasst) – das entstellte Echo des bei aller kritischen Distanz um Differenzierung bemühten «Le Milieu du Monde» (1974).
Hatte Tanner zuvor schon durchaus mit namhaften, aber noch jüngeren weiblichen französischen Stars gedreht, von Bulle Ogier über Juliet Berto bis zu Anne Wiazemsky, so thronte auf der Affiche von «Light Years Away» nun der weltbekannte Name von Trevor Howard. «Les Années lumière», 1981 in Cannes mit dem Grossen Preis der Jury (in der auch Christian Defaye sass, der einflussreiche Moderator von «Spécial cinéma» der TSR) ausgezeichnet, war gleicherweise Parabel auf das Scheitern hochfliegender Träume wie eher eindimensionale Zivilisationskritik, angesiedelt in einer abgelegenen Ecke Irlands. Tanners Lieblingshassobjekt, das Auto, dem er bereits in «Charles mort ou vif» eine fröhliche Bestattung in einer Kiesgrube hatte zuteilwerden lassen, das in «Le retour d’Afrique» (1973) buchstäblich zum köstlich eingesetzten Vehikel seiner Hassliebe zur Vaterstadt wurde, sah sich nun zu einem ganzen Autofriedhof multipliziert, während mittendrin der alte Yoshka vom Fliegen träumte.
Die Erschöpfung des Themas Schweiz, der Verlust der Schweiz als animierender Reibungsfläche, das Wegbrechen der künstlerischen Gewissheiten im Verlauf der siebziger Jahre – sie machten einer Leere Platz, die die dreizehn Spielfilme, die noch kommen sollten, zunehmend verzweifelt mit Sinn zu füllen trachteten. So bot die Hinwendung zum Mediterranen, zum Hispano-Lusitanischen – «L’homme qui a perdu son ombre» (1991), «Requiem» (1998) – nur vermeintlich neue Inspiration. Episode blieb der Dokumentarfilm «Les hommes du port» (1994), ein autobiografisch grundierter Abgesang auf eine Welt der verlorenen Solidarität der Hafenarbeiter von Genua.
Flucht in den Sexus
Einen Ausweg schien zunächst der Sexus zu eröffnen. «Dans la Ville Blanche» (1982), in dem ein von Bruno Ganz verkörperter lyrisch gestimmter Mechaniker der Schönheit der Frauen und der Stadt zu huldigen beginnt, nachdem er in Lissabon von seinem Frachter abgemustert hat – Tanner war seinerzeit selber kurz als Matrose in der Schweizer Handelsmarine zur See gefahren –, folgte noch altbekannten Pfaden. Alle Betulichkeit war dann aber hinweggefegt mit «Une flamme dans mon cœur» (1987) mit und nach einem Stoff von Myriam Mézières.
Tanner hatte mit der französischen Schauspielerin erstmals in «Jonas» zusammengearbeitet, wo sie nicht von ungefähr – aber durch das Drehbuch und Tanners damalige Zweifel gezähmt, ob sich Sexualität im «als ob» des nichtpornografischen Films überhaupt nichtlächerlich darstellen lasse – als Vestalin des Tantra auftrat. Nun animierten sich Regisseur und Koautorin zur Evokation eines (ihres) Amour fou zwischen Paris und Kairo, wie ihn in derart rückhaltloser Selbstentblössung der Schweizer Film noch nie gesehen hatte.
Dass Tanner, der seit seinem vierten Spielfilm ausschliesslich in Farbe gedreht hatte, hier noch einmal auf Schwarzweiss zurückgriff, erwies sich als glückliches Stilmittel gegen jeden vordergründigen Voyeurismus. Erneut war Myriam Mézières Drehbuchautorin und Hauptdarstellerin im ähnlich angelegten, aber mehrschichtigeren «Le journal de Lady M» (1993), während Tanner ihr im hochdramatischen «Fleurs de sang» (2002) sogar die Koregie überliess. Wonach aber zumindest der inzwischen über Siebzigjährige erschöpft schien. Er sollte noch einen Film realisieren, «Paul s’en va» (2003), einen kläglichen Abgesang, Manifest eines trotzig behaupteten analytischen Blicks auf Spätkapitalismus und Konsumgesellschaft und doch vor allem Zeugnis des Wirklichkeitsverlusts eines Künstlers.
Fatale Absage ans Drehbuch
Im Zusammenhang mit «Une flamme dans mon cœur» hat Alain Tanner auch davon gesprochen, dass ihn das Drehbuch «überhaupt nicht mehr» interessiere. Das Gutgemachte, Wohlvorbereitete an einem Film: «ça m’emmerde». Doch nicht nur, dass diese neue Spontaneität zu immer deplorableren künstlerischen Ergebnissen führte – sie verweist auch zurück auf eine entscheidende Bruchstelle: das Ende der Zusammenarbeit mit John Berger. Kennengelernt hatten sich die beiden im Umfeld der Dreharbeiten zu «Nice Time». Zur ersten Zusammenarbeit war es für «Une ville à Chandigarh» gekommen, die knapp einstündige Dokumentation (und ebenso sehr Reflexion) der Arbeiten an Le Corbusiers Musterstadt. Hatte Tanner mit «Charles mort ou vif» primär in der Schweiz Furore gemacht, so weckte der Zweitling, «La Salamandre», über Paris hinaus bereits in London und New York Aufmerksamkeit. Dies war fraglos dem Namen John Bergers zu verdanken, auch wenn der Film ihn nur als «Co-scénariste», Mitarbeiter am Drehbuch, aufführt.
Die Zusammenarbeit sollte noch «Le Milieu du Monde» und, den bekanntesten von allen, «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» umfassen. Zum dazwischenliegenden ingeniösen Kammerspiel «Le retour d’Afrique» hatte Berger immerhin die Idee geliefert, weil Freunde von ihm diese Huis-clos-Situation in der eigenen Wohnung tatsächlich erlebt hatten; typisch Tanner und bejubelt vom Zeitgeist war, dass das junge Paar am Ende einen «Landesverräter» gezeugt hatte …
Wenn Tanner noch lang als der international, also in der angelsächsischen Welt, bekannteste Schweizer Filmemacher galt, so war dies klar den zusammen mit John Berger realisierten Arbeiten zu danken. Berger sorgte nicht nur für handwerklich tadellose, geistreiche Drehbücher, sondern für jenen Witz, auch szenisch, der mit seinem Weggang aus Tanners Werk verschwunden war. Da gab es vergnügliche Bezüge selbst zwischen den Filmen.
Unvergesslich die Szene in der Wurstfabrik in «La Salamandre», in der Bulle Ogier – der Kameramann Renato Berta hat erzählt, wie die Crew der Ankunft der vornehmen Pariserin mit einiger Beklemmung entgegensah – als proletarische Titelheldin, die mit rätselhafter Indifferenz unversehrt durch jedes Feuer geht, ihrer Tätigkeit an der Wurstmaschine ein Ende setzt, bei dem sie diese eine endlose Wurstschlange hervorwürgen lässt.
Wie sich diesem Produkt entfremdeter Arbeit (hierin waren sich die marxistischen Autoren einig) dialektisch das Verständnis des historischen Prozesses abgewinnen lässt, das demonstrierte nun «Jonas». Hier zieht Jacques Denis (der in «La Salamandre» den erfolglosen Schriftsteller Paul verkörperte, der natürlich an der Grenze zu Frankreich lebt) als neuer Geschichtslehrer vor seiner Gymnasialklasse eine ellenlange Blutwurst aus seiner Aktentasche. Von einem Schüler zum Takt eines Metronoms (der Zeit) in Stücke (die Epochen) gehackt, illustriert sie so die Unterteilung des Kontinuums Geschichte. Am Beispiel des noch unversehrten Rests wird eines der Lieblingsthemen Bergers entwickelt, das Weltbild der agrarischen Gesellschaft und dessen allmähliche Ersetzung durch ein kapitalistisches Zeitverständnis. Das war so erhellend wie anarchistisch-witzig.
Zugleich war es auch formal in die Machart des Films übergeführt. Für die «Cahiers du cinéma» hat Alain Tanner seinerzeit ausführlich die künstlerische Konzeption von «Jonas» dargelegt. Der Film sollte (idealerweise) aus einer Aneinanderreihung von Szenen bestehen, die jeweils aus bloss einer einzigen Plansequenz bestanden, wobei die Unwägbarkeiten bei dieser Methode gelegentliche kleine technische Ergänzungen erforderten. Zentral blieb aber die Idee der «organischen» Entwicklung innerhalb der Szene, der entschiedene Verzicht auf jedes Schnitt-Gegenschnitt-Verfahren. Der Kameramann Renato Berta, der von «Charles mort ou vif» (seinem ersten Film überhaupt) bis zu «Messidor» mit Tanner zusammengearbeitet hat, hat geschildert, wie sie sich die Technik der möglichst weitgehenden Vermeidung des Schnitts während der Dreharbeiten zu «Le retour d’Afrique» über lange seitliche Kamerafahrten allmählich erfanden mit dem Ziel, der Kamera eine stärkere Präsenz zu geben.
Ein entscheidendes Jahrzehnt
Es war kein Zufall, dass mit «Jonas qui aura 25 ans en l’an 2000» auch die Zusammenarbeit sowohl mit John Berger wie mit Renato Berta ein Ende fand. Eine künstlerische Methode hatte ihren Höhepunkt erreicht und war an ein Ende gekommen. Die Tragik in Alain Tanners Leben bestand darin, dass er für die weitaus grössere Hälfte seiner künstlerischen Arbeit nie mehr zu vergleichbarem Ausdruck fand. Doch der Schweizer Film wird noch lang Anlass haben, eines entscheidenden Jahrzehnts zu gedenken, in dem er von keinem andern so viel ideellen Anstoss und künstlerische Anregung empfing. – «Paul s’en va» hiess es im filmischem Abschied, der Tanners Alter ego im Titel führte. Nun besteht kein Zweifel mehr: Paul s’en est allé.
Teile dieses Nachrufs sind in der NZZ vom 11./12. September erschienen.