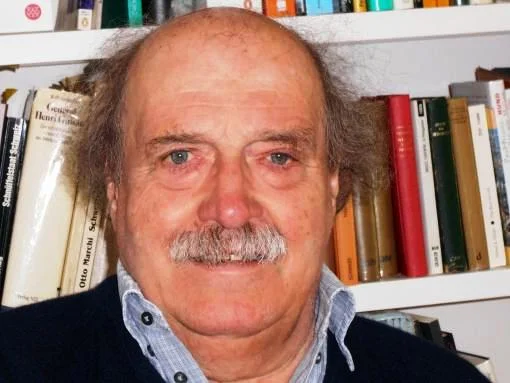
Im „englischen Viertel“, mitten in Zürich, steht ein verwunschenes Häuschen, eine Art Klause. Hier, umgeben von einem Bambuswäldchen, schreibt Urs Widmer seine Texte. Hier empfängt er Journal21.
(Das Gespräch mit Urs Widmer führte Heiner Hug)
Journal21: Urs Widmer, haben Sie einen Computer?
Urs Widmer: Ich benütze einen Computer, habe aber selbst keinen. Ich google auf dem Computer meiner Frau und meiner Tochter. Vor allem brauche ich das Mail. Mein englischer Verleger sitzt in Kalkutta. Dem kann ich keine Briefe schreiben.
Sie schreiben Ihre Texte auf einer guten, alten Schreibmaschine. Was ist das für ein Modell?
Das ist eine mir sehr modern vorkommende, mindestens zwanzig Jahre alte Triumph Adler. Ich empfinde sie deshalb als modern, weil sie ein Löschgedächtnis hat. So kann ich meine Fehler korrigieren. Für meine Art Arbeit ist das die vollkommen ideale Maschine. Ich starre nicht gerne auf Bildschirme. Vor allem korrigiere ich nicht gerne so fix und flink. Auf dieser Maschine muss ich den Text immer wieder lesen. Wenn’s nicht hinhaut, muss ich die ganze Seite abschreiben, und das tut dem Entstehen von Literatur sehr gut.
Finden Sie auch immer wieder Farbbänder und Ersatzteile?
Ich habe eine zweite Maschine gekauft, ein völlig identisches Modell. Sie dient mir als Reservelager. Wenn in der ersten Maschine Teile kaputt gehen, die nicht mehr produziert werden, greife ich auf diese Teile in der zweiten Maschine zurück. Farbbänder gibt’s noch immer an mehreren Orten in Zürich, zum Beispiel bei Herrn Kern am Zeltweg, der mir auch die Maschine repariert und ein enthusiastischer Kenner dieser Materie ist. Aber wenn’s die Bänder nicht mehr gibt, gibt’s die Katastrophe, das ist klar.
Also dann doch ein Computer?
Es sieht ganz so aus.
Staunen die Verlage nicht, wenn sie ein Manuskript erhalten, das mit der Schreibmaschine geschrieben ist?
Auch wenn ich für Zeitungen arbeite, übergebe ich ihnen maschinengeschriebene Manuskripte. Noch nie hat jemand nur im Geringsten protestiert. Die Texte muss auch niemand abtippen, sie werden gescannt.
Sie schreiben die Texte mehrmals. Ist das ein kreativer Prozess?
Das ist so. Ich schreibe in der Regel im Kopf. Es kann sein, dass ich einen romanlangen Text ein Jahr lang im Kopf herumtrage. Dann wird der Innendruck so gross, dass irgendwann das Schreiben kommen muss. Ich schreibe dann den Text von Hand in Skizzenbücher. Früher habe ich das nicht gemacht, jetzt mache ich es so. Ich beschreibe immer nur die rechte Seite im Notizbuch, damit die linke für Korrekturen frei bleibt. Wenn der Text korrigiert ist, geht’s an die Maschine.
Schreiben Sie schnell?
Ich schreibe schnell, oder ich schreibe nicht. Wenn irgendetwas nicht stimmt, dann schreibe ich selbstverständlich die ganze Seite nochmals. Ich lasse nichts hinter mir, was ich nicht für definitiv halte. Ich habe nicht die Haltung, die ja auch legitim ist, dass man sozusagen vorwärts schreibt und dann denkt, später kann ich das nochmals ändern. Das kann ich nicht. Es muss sozusagen fertig sein.
Mir kommt das ganz normal vor, dass ich jede Seite mehrmals schreibe. Es gibt zwar Autoren, die auf Anhieb saubere Texte schreiben. Wenn sie die Manuskripte von Robert Walser anschauen, „Der Gehülfe“ zum Beispiel, das ist ein fehlerfrei heruntergeschriebener Text mit kaum irgendeiner Korrektur oder Veränderung. Das ist phänomenal. Da kann ich nur staunend davorstehen. Auch bei Kafka, beim „Prozess“, ist das Manuskript linear in einer tadellosen Schrift geschrieben.
Es gibt ja Schriftsteller, die sind nie ganz zufrieden mit ihrem Produkt. Wie steht das bei Ihnen?
Da gibt es schon Momente des Zweifelns. Aber – und das hören protestantische Schweizer gar nicht gern - in der Regel bin ich sehr zufrieden, um nicht zu sagen glücklich. Vor allem auch, wenn ich auf die Sachen schaue, die ich vor 40 Jahren geschrieben habe. Es gibt wenig, von dem ich sage, warum hast du das getan, das ist nun wirklich Blödsinn. Es ist beinahe umgekehrt: Ich staune, was ich damals gemacht habe, weil ich das überhaupt nicht mehr so schreiben könnte. Ich könnte den Roman „Die Forschungsreise“ heute überhaupt nicht mehr so schreiben, nicht einmal mehr ansatzweise. Ich habe ihn aber geschrieben, ist das nicht wunderbar?
Sie sagen, Sie seien „glücklich“, wenn Sie etwas geschrieben haben. „Glücklich“, weil der Wurf nach langer Arbeit gelungen ist?
Der Vorgang ist der Glücksbringer. Darum schreibe ich, und es geht ganz vielen so. Das Schreiben ist keine Qual, wie das manche kokett behaupten. Das Nicht-schreiben-Können ist eine Qual. Wenn dies einem Schriftsteller zustösst, ist das natürlich schlimm. Aber das Schreiben und das Schreiben-Können, ist eine Glücksmaschinerie. Da können sie süchtig werden. Ich bin auch ein Süchtiger. Sie sitzen da und kriegen mindestens ein Glückgefühl der zweiten Art.
Wo schreiben Sie, immer hier in Ihrem Büro?
Manchmal bin ich unterwegs, und der Text ist auch unterwegs. Ich verwende Notizbücher. Das kann auch im Zug sein, wenn er nicht überfüllt ist, und wenn nicht alle quatschen. Im Zug kann man ausgezeichnet schreiben, weil das Rollen ein Kreativität unterstützendes Ding ist. Normalerweise schreibe ich hier im Büro.
Es gibt ja Schriftsteller, die arbeiten jahrelang an einem Text. Wie lange haben Sie zum Beispiel an ihrem jüngsten Buch, „Reise an den Rand des Universums 1*), gearbeitet?
Das ging kontinuierlich vorwärts, ein gutes Jahr lang. Ich bin ja auch nicht Proust, der etwas jahrelang mit sich herumträgt – mit einer Ausnahme. Mein Roman „Der Geliebte der Mutter“ basiert auf einer für meine Mutter sehr entscheidender Lebensepisode. Ich wusste, ich will dieses Buch schreiben und werde es schreiben. Doch ich konnte es jahrelang nicht schreiben, aus zwei Gründen: Ich war zu jung und wusste, dass nur ein „alter“ Sohn das schreiben kann. Zweitens: Der Stoff war sehr realitätsnah, und ich musste warten, bis alle Beteiligten tot sind. Doch der Held des Buches, eben der Geliebte, wurde sehr alt, und so musste ich warten.
Kann es vorkommen, dass Sie sich sagen, das ist Mist, was ich geschrieben habe, das werfe ich weg?
Schauen Sie sich die Grösse meines Papierkorbes an. Natürlich schmeisse ich viel weg.
Auch Romantexte?
Ja, während der Entstehung. Aber auch später. Meine Frau ist eine glanzvolle erste Leserin. Sie ist gleichzeitig liebevoll und sackstreng. Sie hat mir aus dem vorletzten Buch 50 bis 70 Seiten einfach ersatzlos rausgeworfen. Das bedeutet dann, dass ich den Rest des Buches nochmals anders schreiben muss.
Da schluckt man dann schon, wenn man 50 Seiten geschrieben hat und die Frau sagt: Schmeiss sie einfach weg. Sie sagt es nicht so grob, aber es läuft darauf heraus. Sie sagt, „da habe ich mich ein bisschen gelangweilt“, „ist das nicht ein bisschen fad?“, „muss das sein?“. Und sie sagt es eben genau an den richtigen Orten. Ich habe gelernt, mich daran zu halten, und das hat meinen Sachen gut getan.
Wann haben Sie sich zum ersten Mal als Schriftsteller gefühlt?
Ich bin früh mit Schriftstellern in Kontakt gekommen. Mein Vater war befreundet mit der halben deutschen Literatur. Ich sah, dass das hochinteressante Typen sind, die können keinen blöden Beruf haben.
Mein Vater war ja ein Mann des Wortes, er war Übersetzer und er schrieb auch selber Erzählungen, Kinderbücher und Jugendromane. Da hatte ich also einen vor der Nase, der schrieb. Der erste Kick war eine Schnitzelbank. Mein Vater machte bei jeder Familienfeier Schnitzelbänke, ich dann bald auch. Ich war etwa 14 als wir beim Geburtstag eines Freundes Schnitzelbänke vortrugen - und ich habe meinen Vater an die Wand gesungen. Ich war eindeutig besser. Das war eine Art Schlüsselerlebnis: Man kann seinen Vater übertreffen. Er war stinkeifersüchtig und beleidigt. Auf mich prasselte das Lob der Geburtstagsgesellschaft herein. Das war ein wichtiger Moment.
Ich habe dann erst mit 30 etwas geschrieben, das ich für publizierbar hielt. Zwar hatte ich vorher schon geschrieben, aber ich habe die Texte nie jemandem gezeigt, denn ich wusste: Das ist es nicht. Also war ich schon früh ein Schriftsteller, nur eben ein miserabler.
Kann man in der Schweiz von der Schriftstellerei leben?
Ich kann seit mehr als 40 Jahren von meinem Schreiben leben. Das war nicht immer ganz toll. Ich habe eine ebenfalls Geld-verdienende Frau. Als Sicherheitsanker ist das ganz wichtig, aber ich könnte auch allein vom Schreiben leben.
Da gab es ganz reiche und mittlere Jahre. Jetzt bin ich in den mittleren Jahren. Ich würde keinem anraten, Schriftsteller zu werden, wenn er denkt, er könne damit reich werden. Das gelang nur Dürrenmatt. Es gibt in der Schweiz sicher nicht mehr als eine Hand voll Schriftsteller, die vom Schreiben leben können.
Wie wichtig ist das Autobiografische in Ihrem Werk? Viele Schriftsteller verarbeiten ja selbst Erlebtes, so zum Beispiel Max Frisch im „Montauk“.
Gerade von Frisch möchte ich mich gerne abgrenzen. Einen „Montauk“ möchte ich nicht geschrieben haben. Ich finde Montauk ein schamloses und ein schlechtes Buch. Gerade deshalb, weil Frisch mit einer falschen Koketterie zu Beginn schreibt, er wolle jetzt ganz aufrichtig sein und nur die Wahrheit sagen. Dann kommt eine ganze Kette von Geschichten, die eigentlich ein Verrat an den Leuten sind, die um ihn herum sind: hauptsächlich an einer Frau und auch an einer zweiten. Stellen sie sich vor, sie liest ein Jahr später detailliert, wie sie mit Frisch im Bett gewesen ist.
Ich weiss nicht, woher Geschriebenes, Empfundenes kommen soll, wenn nicht aus dem eigenen Leben. Auch die Fantasie gehört dazu. Mir wird normalerweise eher nachgesagt, ich sei ein fantasiereicher Schreiber. Meine eigene Autobiografie spielt in ganz vielen Büchern keine sichtbare Rolle. Dieses Autobiografische kam zum ersten Mal einigermassen deutlich im „Blauen Siphon“ und dann natürlich im Mutter- und Vater-Buch zum Vorschein. Und jetzt wieder im allerneuesten Buch; das ist eine Autobiografie der ersten dreissig Jahre.
Die obligate Schlussfrage: Welche Pläne haben Sie?
Das ist jetzt ein wunder Punkt. Ich habe Hoffnungen und keine Pläne. Seit dem letzten Buch habe ich nichts Literarisches geschrieben. Diese Autobiografie, die die Zeit von 1938 bis 1968 behandelt, habe ich eigentlich unfreiwillig geschrieben, weil ich nichts Anderes hatte. Es ist so etwas wie das letzte Buch.
Was nun? Wenn man 75 ist, denkt man das gar nicht so gern. Die Hoffnung ist, dass hinter diesem möglicherweise letzten Buch, eine Mauer einstürzt - und etwas ganz Anderes kommt zum Vorschein. Vielleicht schreibe ich eine ganz fantastische Geschichte, die endlich einmal gar nichts mit mir zu tun hat. Oder ich schreibe eine Biografie über irgendjemanden. Ich habe keinen Plan.
1) Urs Widmers autobiografischer Roman „Reise an den Rand des Universums“ erschien im August im Diogenes-Verlag

