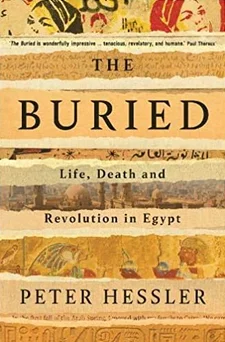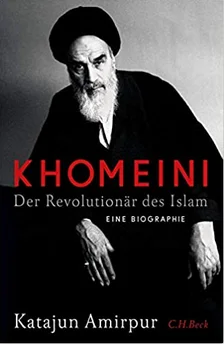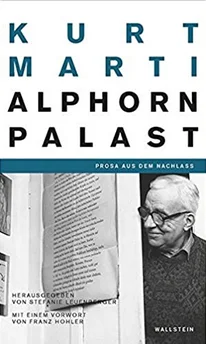Wer die Deutschen sind
Nie haben Sie mit geringerem Aufwand über die Deutschen Klarheit erlangen können. Und nie aus soliderer Quelle. Der mannigfach preisgekrönte Neuzeithistoriker Heinrich August Winkler, einer der führenden Köpfe namentlich in der Zeitgeschichte des Westens, hat ein halbes Jahrtausend Werdegang der deutschen Nation in ein Destillat von 230 Seiten gepackt: „Wie wir wurden, was wir sind. Eine kurze Geschichte der Deutschen“ (C. H. Beck, 2021). Auf fünfzig Seiten des gewundenen Wegs zur staatlichen Einheit gelangen wir von Luther bis ins 20. Jahrhundert. Auf 25 vergleichsweise geduldigen Seiten missrät das Experiment der Weimarer Republik. Die zwölfjährige Katastrophe von Hitlers Machtergreifung bis zum Zusammenbruch seines Dritten Reichs nimmt darauf gerade 27 Seiten ein. Es folgt eine zweite Buchhälfte zum „postnationalen Sonderweg“ der in zwei Staaten geteilten Nation, zur Ablösung der deutschen Frage durch ihre europäische Fortsetzung und schliesslich durch eine Gegenwart, in der bis heute viel Geschichte präsent geblieben ist. Auch von der EU und ihrer Karriere wird ein griffigerer Abriss kaum zu haben sein. Bis in den Sommer 2020 führen uns Winklers Monographie und ihr Nachwort „Im Zeichen von Corona“. Der so sehr gedrängte Stoff ist in einer Sprache aufbereitet, die Autoren unter den Akademikern ein leuchtendes Vorbild gibt.
Die Mutter der Welt
Mit Winklers Buch bin ich in einem Verkehrsflugzeug von Egyptair auf halbem Weg von Milano Malpensa nach Kairo fertig geworden, und ein zweites fabelhaftes, diesmal sehr viel schweres Buch wartet im Handgepäck: „The Buried. Life, Death and Revolution in Egypt“ (London: Profile Books, 2019) von Peter Hessler, Staff Writer der amerikanischen Wochenzeitschrift „The New Yorker“. Im Oktober 2011, dem Jahr des Arabischen Frühlings, lässt Hessler sich mit seiner in New York aufgewachsenen chinesischen Ehefrau und ihren zwei anderthalbjährigen Zwillingstöchterchen auf der Nilinsel Zamalek in Kairo nieder, wo die Familie bis Mitte 2016 bleiben wird. Zuvor ist er während sieben Jahren Korrespondent seiner Zeitschrift in Peking gewesen, was im Reich der Mitte seine Leidenschaft für Altertümer entfacht hat. Was ihn in den Nahen Osten gelockt hat, sind ebenso sehr die Pharaonen wie die Araber an ihrem zeitgeschichtlichen Wendepunkt 2011. In rasch enger werdenden freundschaftlichen Beziehungen mit Sayyid, dem Zabal – das ist der Müllmann – seiner Strasse in dem Wohlstandsbürgerviertel, und dessen Familie, mit seinem Arabischlehrer Rifaat und mit seinem homosexuellen Rechercheassistenten Manu lernt Hessler in exemplarischen Prisen Alltagsnöte und -kämpfe in der ägyptischen Gesellschaft kennen.
Im Pflichtpensum seines Jobs verfolgt der Reporter von nahem den Aufstieg des Muslimbruders Mohammed Mursi zum ersten frei gewählten Präsidenten Ägyptens im Juni 2012 und den Militärputsch General Sisis im Juli 2013 mit den folgenden Massakern unter den Anhängern Mursis. Seine Kür derweil umfasst zahlreiche Besuche der Grabungsstätten im Niltal. „The Buried“ im Buchtitel, ein pharaonischer Friedhof, ist eine davon. Amerikanische und einheimische Archäologenteams machen ihn nicht nur mit den neueren Fragestellungen der Ägyptologie vertraut, was insbesondere die Lebensumstände der einfachen Leute unter den Pharaonen angeht, sondern ebenso mit der ägyptischen Selbstorganisation gegen die Heerscharen von Plünderern während der fast vollständigen Absenz von Sicherheitskräften in den Revolutionsmonaten. Hessler kommt in engen Kontakt zu zahlreichen kleineren und grösseren Granden der ägyptischen Lokalpolitik und ihren Grossfamilien, verfolgt Lokalwahlkämpfe in Provinzstädten wie Assyut und Mina und in Dörfern am Ufer des Stroms. Alsbald ahnt man, worauf Ägypter hindeuten, wenn sie ihr Land „ummu'd-dunya“ nennen – „die Mutter der Welt“: Die Kultur, so murmeln sie alle ergebenst, reicht hier 7000 Jahre zurück ..., weshalb sie sich nicht über Nacht umkrempeln lässt.
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass die 1928 gegründete Muslimbruderschaft nicht mehr zuwege gebracht hat, als die engen Grenzen ihrer Macht zu offenbaren: Ein ephemerer Höhenflug hat den an Zahlenstärke immer weit überschätzten Geheimbund für anderthalb Jahre in den Rang des überragenden politischen Problems Ägyptens erhoben und dem ganzen Land klargemacht, dass seine Organisationstalente über die eigenen Zellen nicht hinausreichen. Als politische Partei mit Regierungsverantwortung hat die Bruderschaft nach Strich und Faden versagt, ist zu gar nichts zu gebrauchen gewesen.
Unterdessen hat Hessler in der Provinz Kleinkolonien von Chinesen entdeckt, die mit Maschinerie aus dem Fluggepäck Produktionsanlagen einer behelfsmässigen Textilindustrie zusammengebastelt haben und, bestritten vor allem durch die Frauen, einen florierenden Handel mit Unterwäsche in Gang halten. Das Kontrastprogramm ihres Beispiels zeigt dem Chinakenner mit frappanter Deutlichkeit, woran Ägypten krankt: am immer noch sehr weitgehenden Ausschluss der Frauen aus dem Wirtschaftsleben, von der Politik nicht zu reden. Das Problem der ägyptischen Männerwelt ist dabei mehr noch als der martialische Charakter ihres Herrschaftsapparates dessen rundum und durchweg methodenfreie Willkür, um nicht zu sagen Chaos, kein System nirgendwo. Für allgemeine Lähmung in diesem organisatorischen Urzustand sorgt zudem die böse Überalterung seines Spitzenpersonals in einem Land, wo die Hälfte der Bevölkerung 15 Jahre und jünger ist. Fürs Überleben im Niltal bildet die einzige Gebrauchsanweisung bis auf Weiteres das sklerotische ägyptische Familienmodell.
Kritiker haben sich darüber gestritten, ob ein Amerikaner die Geschichte der jüngsten fehlgeschlagenen Revolution Ägyptens schreiben kann. Hesslers Buch ist ein Juwel an Grassroots-Reporting, Meisterstück einer Erzählkunst, die nichts überfliegt und unter dem Pflaster die Wurzeln der sozialen Alltagswirklichkeit freilegt. Zuletzt resümiert er ein Jahrhundert ägyptischer Zeitgeschichte anhand der Geschichte des Art-déco-Hauses, seiner Erbauer und einstigen Eigentümer, wo seine Familie fünf Jahre in der Parterrewohnung gelebt hat.
Der Ayatollah war nicht der Urheber des heutigen Iran
Um im Vorderen Orient und unter Muslimen zu bleiben: Falls das Problem des gegenwärtigen Iran das Vermächtnis Khomeinis ist, dann jedenfalls mitnichten ein unverfälschtes Erbe. Dies unter anderen will eine neue Biographie des Ayatollah zeigen, „Khomeini. Der Revolutionär des Islam“ (C. H. Beck, 2021), geschrieben von der Kölner Islamwissenschaftlerin Katajun Amirpur. Sie überrascht in vielem, nicht nur weil der grimmig vor sich hin blickende Ayatollah die Frauen zu verstärkter öffentlicher Präsenz und Engagement in der Arbeitswelt ermutigte. Uns wird ein hierzulande ganz unbekannter Mystiker und Lyriker (geb. 1902) vorgestellt, der in der Tradition der persischen Klassiker Saadi und Hafiz in deren Metrum der Ghaselen seinen Gesang von Liebe, Wein und Weib unerschrocken dem Papier anvertraute, noch im Jahre seines Todes im 87. Altersjahr.
Auch den wohl wichtigsten Staatsmann der islamischen Welt in den letzten fünfzig Jahren lernen wir von neuen Seiten kennen. Zehn Jahre Khomeini von seinem Antritt in Teheran 1979 bis zu seinem Tod 1989 hatten wenig gemein mit den bleiernen drei Jahrzehnten seither. Seine Staatsdoktrin der Islamischen Republik mit der für sie bestimmenden „velayat-e faqih“, der „Herrschaft des Rechtsgelehrten“, unterschied sich im entscheidenden Punkt vom klerikalen Absolutismus, den sein Nachfolger durchgesetzt hat: nämlich in der von Khomeini geforderten Legitimation des höchsten Führers durch das souveräne Volk. Nur Monate nach dem Tod des Revolutionsführers sind diesem Modell durch mehrere Verfassungsänderungen die republikanischen Milchzähne gezogen und die Herrschaft des vom Volkswillen bestätigten höchsten Geistlichen durch die „velayat-e motlaqe“ ersetzt worden: durch die „absolute Herrschaft der Unfehlbaren“, wonach der einmal inthronisierte Diktator durch keine ihm untergebene Körperschaft mehr aus dem Amt zu entlassen ist.
Spätere Schriften von Khomeinis erstem, bald jedoch durch seine Rivalen kaltgestelltem Stellvertreter Hosein Ali Montazeri legen die wohlbegründete Annahme nahe, dass der achtzigjährige Revolutionsführer, der laut Montazeri den Krieg mit dem Irak bereits 1982 beenden wollte (er dauerte schliesslich bis 1989), die politischen Geschicke des Landes in seinen letzten Lebensjahren nicht mehr in der Hand hatte, sondern von einem Triumvirat aus seinem Sohn Ahmad, Ali Akbar Rafsanjani und Ali Khamenei kontrolliert wurde, die ihn über die Tagesaktualitäten systematisch falsch informierten.
Die Deutsch-Iranerin Amirpur berichtet solche aufsehenerregenden zeitgeschichtlichen Neuigkeiten und Korrekturen trocken und aufgeräumt, leicht und schön zu lesen wie schon ihre Einführung „Der schiitische Islam“ (Reclam, 2015).
Gottes Rückkehr nach Westen
Den Lehren Khomeinis gemäss ist also wahre Gottesherrschaft nicht vereinbar mit der Menschenherrschaft selbstermächtigter Tyrannen. Womit wir Gott näher gekommen sind, dessen Rückkehr auch im Okzident beständig unübersehbare Fortschritte verzeichnet, zumindest in Buchläden, aber seit einiger Zeit auch an Universitäten in Veranstaltungsangeboten des Philosophischen Seminars. Weniger populär sind – zumindest in nicht ganz traditionell oder konventionell gläubigen Kreisen – einstweilen noch das Ewige Leben und etwaige Übergänge dahin. Im Verlag Herder, dem nichts Religiöses fremd und Gott schon lange nahe ist, erschien letztes Jahr ein hübsches Feuilleton, empfohlen für Rückflüge aus dem Orient, zumal in Corona-Zeiten: „Warten auf Gericht und Erlösung: Poetischer Streit im Jenseits“ von Sibylle Lewitscharoff und Heiko Michael Hartmann (Herder, 2020).
Unverkennbar westlich individuell begifteln und umschmeicheln sich zwei schwer zu greifende Ungestalten, weiblich die eine, männlich der andere. Schwerelos badend in einem lichtlosen Nirgendwo, schon tot oder jedenfalls nicht mehr recht lebendig, von ihren Sinnen nur das Gehör übrig, vor den erblindeten Augen ein schwarzer Nebel, durch den gelegentlich ihnen mehr und minder vertraute Gestalten vorbeihuschen, um ihre Fragen und Mutmassungen mit weiterer Nahrung zu versorgen. Die Frau die bange Zuversicht, der Mann mit dem Ingrimm des Spielverderbers. Wer sind sie, falls überhaupt noch sich selber oder was sie waren, wovon nur vagste und unsicherste Ahnungen geblieben sind. Ihre Erwartungen und Befürchtungen, die gewiss aufs Kommende abzielen, können, das muss ihnen auffallen, nur aus dem Vorleben stammen, was ihnen gar nicht weiterhilft. Doch daran räkeln sie sich im Wechselspiel auf, bemüht, sich gegenseitig fertigzumachen. Mit frommen Wünschen und kindlichen Illusionen meint er, wolle sie ihn und sich selber liebkosen; inquisitorisch und geisttötend schimpft sie seine überlegene Unnaivität. Viele erlesene Bonbons, viel Bildungsgut. Doch kein haltbarer Zustand, in solch prekärer Lage auch noch so ein Hickhack, und darin auszuharren nicht eigentlich eine Perspektive, aber was wollen sie, die sich nicht fertigzusterben trauen? Je mehr sie sich dagegen zur Wehr setzen, desto stärker wird die gegenseitige Abhängigkeit. Aus etwas Distanz ein wortreiches, hoch und höher greifendes „Warten auf Godot“.
Gott ist nicht ohne einen Priester zu haben. Unter den zahlreichen Neuauflagen und Erstausgaben zum 100. Geburtstag Kurt Martis am 31. Januar möchte ich deshalb eine kleine Sammlung aus dem Nachlass herausheben: „Alphornpalast“ (Wallstein, 2021). Niemand weiss Genaueres über das ominöse Bauwerk im Westen, und als Gaston ihn endlich betrat, traf ihn sogleich der Blitz, berichtet seine Frau Julia, mitten unter der Kuppel, sonst weiss er nur von der Ambulanz zu berichtet, die ihn zum Notfall gefahren hat. Doch aufgeben will Gaston nicht. Die kleinen wunderbaren Essays und Erzählstücke führen vor, dass Marti nicht nur als allseits bekannter Verskünstler in der Klasse Franz Hohlers und Mani Matters gespielt hat, sondern auch als Intellektueller und Zeitzeuge in der Klasse seines Jahrgängers Friedrich Dürrenmatt und Max Frischs, die er beide mitunter ihn fürchten zu lehren verstand – so in den 15 Seiten von „Herr Fremd“, einem „Phantombild“, wie der Untertitel verschmitzt verrät.
Warum lesen ... ?
„Warum Lesen“ hat der Suhrkamp Verlag 24 seiner Autoren gefragt, die, so verspricht es der Untertitel der Anthologie, „Mindestens 24 Gründe“ dafür liefern (Suhrkamp Verlag, 2020). Warum, lautet die grosse Frage, nicht etwa wozu, denn die Frage nach Absicht und Zweck müsste die Aktivität des Lesens zu einem Mittel degradieren. Vielleicht hat einmal jemand behauptet, warum lesen? wäre eigentlich eine einfache Frage, genau wie die Antwort, nämlich weil und damit wir es können? Der Suhrkamp Verlag muss ihn geflissentlich überhört haben. Stattdessen macht er wieder einmal deutlich, dass seine Fragen ganz nach Massgabe der Antworten durchaus anspruchsvoll sind.
Nicht minder ist man es von den Autoren aus dem Haus Suhrkamp gewohnt. Der neunzigjährige Jürgen Habermas handelt die Frage über einen Zeitraum von 5000 Jahren ab, solange es eben schon Schriftzeichen gibt, deren Ankunft der Leser notgedrungen den Vortritt zu lassen hat. (Der Titel dieses verständlicherweise längsten Beitrags des Bands: „Warum nicht lesen?“ soll übrigens keine Einladung zum Nichtlesen sein.) Über der weiten Landschaft, die damit eröffnet ist, sind davor und danach mehrheitlich avancierte Prosaistinnen und Prosaisten auf eine Flughöhe bedacht, die den Blick des Lesers aufwärts lenken muss. Etliche von ihnen halten es mit Friederike Mayröcker, die lesend die Welt erklärt bekommen möchte, und scheinen darauf gefasst zu sein, dass an den hier erhältlichen Erklärungen manches der Erklärung bedarf. Und nicht nur die Welt, denn in seiner „Bitte um Auskunft“ erinnert Hans Joas an die heiligen Bücher, worin es noch um anderes als diese Welt geht.
„Warum Comics lesen?“ erläutert Nicolas Mahler in einem Comic. Der Soziologe Hartmut Rosa muss sich alle Tage nach dem Aufwachen und vor dem Einschlafen mit Hilfe eines Buchs für wenigstens einige Augenblicke woanders aufhalten, es geht nicht anders, selbst wenn ihm hinterher beim Duschen kaum Zeit sich abzutrocknen bleibt. Noch irre ich in dem vielfältigen, reichhaltigen Band weiter herum: „Im Zweifel probiert man’s einmal miteinander“, so hält es Thomas Köck auch mit Büchern, „schaut, was passiert, weil nie lernt man so viel wie im Scheitern und bei Missverständnissen.“ Tröstlich. Ganz läse dieses Buch nur, wer damit und nur damit eingesperrt wäre, was aber beides im Konjunktiv stehen bleiben darf.
... und woher all die Bücher?
Ein wunderbarer Band im lawinenförmigen Ausstoss des Frankfurter Verlagshauses darf nicht übersehen werden: „Über das Verhalten in der Gefahr“ (Suhrkamp, 2020), Essays des Gründers Peter Suhrkamp (geb. 1891) aus den Jahren 1918 bis 1957. Hier endlich finden wir ergänzt, was wir in dem Bändchen der Bibliothek Suhrkamp von 1960, „Der Leser. Reden und Aufsätze“, lesen durften. Der Band versammelt nicht nur Essays zu grossen Autoren wie Paul Claudel, Virginia Wolf, T. S. Eliot, in einer Reihe mit Brecht, Beckett, Hesse, auch Albert Schweitzer und gewiss wiederum Proust, dessen deutsche Rechte Suhrkamp durch den Verkauf des Ferienhauses seiner Ehefrau – am Wattenmeer auf Sylt – an Axel Springer erworben hat. Nach Zeitbetrachtungen zwischen den Kriegen lesen wir in seinem „Tagebuch des Zuschauers“ von 1942/43. Das Nachwort der Herausgeber führt uns auf Suhrkamps Weg aus dem Verlagshaus S. Fischer, wo er vor dem Krieg angefangen hatte, in sein eigenes, das der ostfriesische Bauernsohn und einstige Volksschullehrer 1950 mit Unterstützung der Winterthurer Familie Reinhart gegründet hat. Viel Zeit wird ihm in der Folge nicht mehr bleiben. Im Jahr seiner Gefangenschaft vom Februar 1944 bis zum Februar 1945, erst in einem Berliner Gestapo-Gefängnis und dann im Konzentrationslager Sachsenhausen, hat ihn die Tuberkulose unwiederbringlich seine Gesundheit gekostet. 1959 stirbt er 68-jährig.