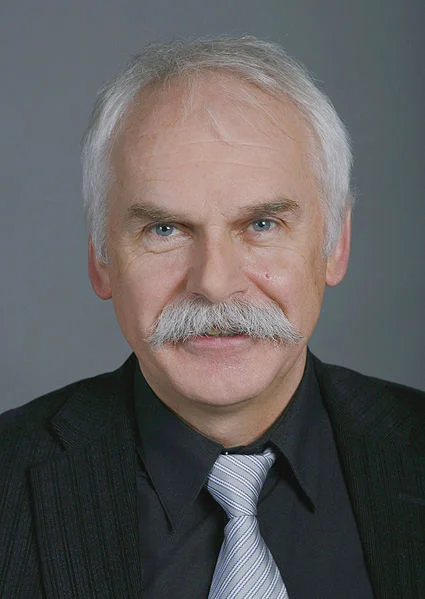Journal21: Hugo Fasel, wenn von sozialer Sicherheit die Rede ist, an was denken Sie da zuerst, an minderbemittelte AHV-Rentner, an alleinerziehende Mütter, an ausgesteuerte Arbeitslose oder an ordentlich Pensionierte, deren Pensionen aber auf die Dauer nicht so sicher sind?
Hugo Fasel: Es sind ausgesteuerte Arbeitslose, es sind alleinerziehende Mütter, auch hin und wieder und zunehmend Väter, und da sind ja immer auch Kinder mit davon betroffen. Eine grosse Kinderzahl ist ein Armutsrisiko. Und es sind Jugendliche, die den Zugang zum Arbeitsmarkt nicht gefunden haben. Das sind die akuten Probleme, die wir gegenwärtig haben und die wir unter dem Titel der „neuen Armut“ zusammenfassen. Und da sehe ich die wichtigste Herausforderung für die sozialpolitische Zukunft.
Journal21: Heisst das mit anderen Worten, dass die Probleme jener älteren Menschen, die nicht mehr arbeiten, mehr oder weniger gelöst sind?
Eine Antwort ist ziemlich heikel, wenn man an diejenigen fünf Prozent unter den Alten denkt, die tatsächlich zu wenig haben und neben all den anderen leben müssen, die genug haben. Aber man kann schon sagen, dass die Schweiz das Problem der Alterssicherung, nicht zuletzt dank den Ergänzungsleistungen, in den ganz grossen Zügen gelöst hat.
Worum es jetzt geht: Diese AHV muss auch für die Zukunft gesichert sein. Und die Pensionskassen stehen vor der grossen Herausforderung, wie sie mit kommenden Inflationstendenzen umgehen sollen, denn die Pensionskassen haben keinen Teuerungsausgleich vorgesehen. Das sind die grossen Aufgaben für die soziale Sicherheit der Alten.
Journal21: Würden Sie denn sagen, dass die soziale Sicherheit heute nicht mehr stabil ist, sondern abbröckelt?
Wir haben über die Frage der Sozialwerke hinaus in der Schweiz ein zentrales und rasch wachsendes Verteilungsproblem. Die alte ökonomische Frage: Wie verteilt man Reichtum in einem Land? ist unter den aktuellen Umständen von Wachstum neu gestellt. Sie wird überdeckt durch die Tatsache, dass wir in den letzten zehn Jahren mehr oder weniger ein gutes Wirtschaftswachstum hatten und alle ein bisschen davon profitieren konnten, weil auch die Inflation nahe bei null war, aber das wird sich in den nächsten Jahren radikal ändern. Radikal!
Es ist absehbar, dass die Folgen der Schuldenkrise auf die Schwachen abgewälzt werden wird, auch auf die Löhne. Da kommen massive Probleme auf uns zu, die bis weit in den Mittelstand hineinreichen. Dass sich die Reichsten praktisch unbeschränkt gegenseitig Geld zuhalten, ist der andere Teil des Problems. Das Verteilungsproblem kommt also wieder auf den Tisch, weil es natürlich zuerst darum geht, mehr Verteilungsgerechtigkeit zu schaffen. Die Folgen einer ungerechten Verteilung können nicht einfach auf die Sozialwerke abgeschoben werden.
Journal21: Sie sind seit drei Jahren nicht mehr Mitglied des Nationalrates. Wie beurteilen Sie den sozialpolitischen Leistungsausweis des Parlaments nach Ihrem Ausscheiden?
Das ist wie immer ein durchzogenes Bild. Bei der Arbeitslosenversicherung hat man abgebaut. Zwar hat sich nach der Bankenkrise die Arbeitslosigkeit verdoppelt, aber statt dass man die Banken zur Kasse gebeten hätte, die ja die Krise mit verursacht haben, hat man die Leistungen abgebaut. Es werden also jene bestraft, die unter der Krise zu leiden haben. Positiv ist, dass der x-te Versuch, die AHV zu schwächen, nicht gelungen ist. Bei den Pensionskassen wurde zumindest die Transparenz verbessert, vor allem gegenüber den Versicherungsgesellschaften. Anderseits hat man bei der IV den Druck auf die Versicherten massiv erhöht mit dem Resultat, dass einige der Probleme einfach auf die Sozialhilfe abgeschoben wurden. Diese muss nun einspringen.
Die Frage der neuen Armut aber hat das Parlament bis heute nicht erreicht. Da stehen noch Lernprozesse an.
Journal21: Es wird in der Politik viel über die Altersvorsorge, aber wenig über die Jugendarbeitslosigkeit geredet. Werden da die Gewichte auf die richtigen Themen gelegt?
Es gibt heute ein systematisches Nicht-zur-Kenntnis-Nehmen der Probleme einer neuen Sozialpolitik. Das geht bis zu einer eigentlichen Verweigerung. Wenn zum Beispiel die Swiss ihr Kabinenpersonal zu Löhnen beschäftigt, die nahe oder sogar unterhalb der Grenze liegen, bei der die Sozialhilfe einsetzt, dann wäre das ein Thema, das eigentlich diskutiert werden müsste. Man versucht bewusst, die Sozialhilfe in die unterste Ebene und in den Bereich der Intransparenz abzuschieben, um zu verhindern, dass sie zu einem politischen Thema wird. Was den politischen Umgang mit der sozialen Sicherheit angeht, stehen wir vor einer Wand der Verweigerung.
Journal21: Sehen Sie dahinter auch die Meinung, dass ein bisschen Armut und Arbeitslosigkeit der sozialen Stabilität gut tun?
Die Schweiz hat ja nicht daran gelitten, dass sie für den sozialen Ausgleich in der Vergangenheit gesorgt hat – im Gegenteil. Vielleicht hilft da ein Blick in die USA. Die USA haben Sozialhilfe immer verweigert, und heute merkt man dort, dass einem so die soziale Stabilität abhanden zu kommen droht und dass man damit auch nicht wettbewerbsfähiger wird.
In der Schweiz aber ist das Vertrauen auf den Markt, der alle Probleme lösen wird, immer stärker geworden. Diejenigen, die diese Meinung vertreten, gehören einer Art Religion, einem Kreis von Erleuchteten an. Und mit Erleuchteten ist es immer schwierig, eine Diskussion zu führen.
Die Wirkung dieser vorherrschenden Haltung wird dadurch zusätzlich kompliziert, dass sozialpolitische Probleme immer mit einer halben Generation Verspätung erst sichtbar werden. Die Inkubationszeit sozialpolitischer Probleme ist relativ lang. Wenn Jugendliche heute keinen Zugang zum Arbeitsmarkt finden, dann sind die Konsequenzen davon ungefähr zehn Jahre später in aller Schärfe zu erkennen. Wenn heute 260‘000 Kinder in armutsbetroffenen Familien leben, dann weiss man ganz genau, dass das eine Unterhöhlung auch grundliberaler Prinzipien ist, nämlich der Chancengleichheit. Und wir beginnen wieder, Armut zu vererben. Diese Instabilitäten, die heute gebaut werden, die kosten in der nächsten Generation weit mehr, als wenn heute für Integration etwas mehr ausgegeben würde. Kurz: Aufwendungen für die Sozialpolitik sind nicht einfach Ausgaben – es sind Investitionen in der Gegenwart, die morgen ihre Früchte tragen. Es ist neben allen ethischen und poltischen Argumenten kostengünstiger, soziale Probleme und damit auch Armut an der Wurzel zu bekämpfen, statt immer nur die Folgen von Verhältnissen der Armut zu lindern.
Journal21: Ich möchte mich jetzt den Parteien zu wenden. Sie waren christlich-sozialer Nationalrat und Gewerkschaftspräsident. Es ist klar, dass Sie taugliche Rezepte eher auf der Linken sehen. Aber gibt es in der Mitte und rechts Vorschläge, an denen Sie einen guten Faden finden?
Das Bedauerliche ist, dass von dieser Seite keine Vorschläge kommen. Es gibt nur den Vorschlag, die Beiträge an die AHV nicht zu erhöhen, was zu Leistungsabbau führen muss. Das ist untauglich. Sonst habe ich weder von FDP noch von SVP Vorschläge gesehen, die als Diskussionsbeiträge irgendwie ernst zu nehmen wären.
Im Gegenteil. Das ist ja der Trick. Um Sozialpolitik nicht machen zu müssen, hat insbesondere die SVP soziale Probleme zu Ausländerproblemen umgedeutet. Das ist eine der zentralen Veränderungen, die wir in den letzten Jahren immer deutlicher erlebt haben.
Wenn man sagt: Es gibt Armut in der Schweiz, heisst es: Da sind vermutlich viele Ausländer dabei. Das ist eine bewusste Verzerrung, und das ist die heutige Dramaturgie für die Sozialpolitik.
Journal21: Und die Linke? Da hört man vor allem: mehr staatliche Hilfe, mehr staatliche Umverteilung. Ist denn das heute noch der Weisheit letzter Schluss?
Ich erwarte, dass man auf der Linken wieder zu grundsätzlichen Fragen zurück kehrt. Es gibt auch ja auch da Leute, die ein grosses Vertrauen in den Markt haben. Aber da muss man sich fragen: Was hat ökonomischer Erfolg mit Stabilität zu tun. Und die Antwort ist klar: Der ökonomische Erfolg muss immer zusammen mit der Verteilungsfrage betrachtet werden. Wir müssen die Verteilungsfrage neu diskutieren, und das bedeutet: Lohndiskussionen in diesem Land. Und es bedeutet ausserdem Lösungen suchen für Leute, die in ihrer Berufstätigkeit Brüche erleiden. Und es bedeutet schliesslich eine Bildungspolitik, die diesen Namen verdient. Ohnehin ist die Bildung eines der Schlüsselthemen der Zukunft. Da erwarte ich mehr Engagement der Linken. Und da muss ich auch die Grünen kritisieren. Weil sich da einige von diesen neoliberalen Sichtweisen haben verführen lassen, blenden sie fundamentale Fragen aus.
Da bin ich von den Grünen enttäuscht. Weil sie mit einem Thema Erfolg haben, blenden sie andere Themen wegen deren Komplexität aus. Sie tun es natürlich auch, um Meinungsverschiedenheiten innerhalb der Partei gar nicht aufkommen zu lassen. Die Politik der Grünen muss breiter werden, gerade auch im Bereich der Sozialpolitik. Da sind sie schwach.
Journal21: Jetzt haben Sie die Grünen kritisiert. Gilt das Gleiche auch für die Sozialdemokraten?
Die SP ist thematisch breiter angelegt und wird darum wohl auch einige Verluste erleiden. Aber das ist wohl ein grundsätzliches Problem. Wer heute die politischen Fragen in einer gewissen Breite angeht, der hat Mühe, diese Themen in ihrer Komplexität zu den Wählerinnen und Wählern zu bringen. Ich hoffe, dass die Sozialdemokraten in dieser Breite weiter politisieren, aber damit ist natürlich immer ein Kommunikationsproblem verbunden. Da ist dann die Verantwortung der Parteiführer gefragt, nicht nur an die nächsten Wahlen zu denken.
Journal21: Hat die relative sozialpolitische Ergebnislosigkeit der letzten Jahre damit zu tun, dass im Parlament eine Art Patt-Situation herrscht?
Das ist eine schwierige Frage. Mir ist aufgefallen, dass nur noch wenige neue Themen überhaupt ins Parlament kommen. Die Arbeit im Parlament wird, wie ich das schon gesagt habe, beherrscht durch eine Umlenkung praktisch jeder Frage in eine Ausländerfrage. Es findet eine Fütterung nationalistischer Emotionen statt.
Diese Zuspitzung haben wir erlebt. Neuerdings wird ja sogar behauptet, Autobahnstaus hätten mit Ausländern zu tun. Sozialfürsorgeleistungen werden mit Ausländern in Beziehung gebracht. Steigende Mietpreise werden auf Ausländer zurück geführt. Ja sogar die Umweltpolitik ist davon betroffen: Hätten wir weniger Ausländer, so hätten wir weniger CO2. Dieser politisch konstruierte Zusammenhang bestimmt natürlich auch das Verhalten der Parteien im Parlament.
Aber es gibt auch die Bürgerinnen und Bürger, die bereit bleiben müssen, die politischen Fragen in ihrer Komplexität zu bedenken, den Dingen auf den Grund zu gehen und sich nicht einfach durch Emotionen leiten zu lassen. Es braucht bei den Bürgerinnen und Bürgern eine Verantwortung für das Ganze. Das ist eine unabdingbare Voraussetzung. Bei den Generationen, die den 2. Weltkrieg erlebt haben, war diese Erfahrung selbstverständlich. Für die Menschen heute ist eine solche Haltung nicht mehr einfach so durch die konkrete gesellschaftliche Erfahrung gegeben.
Journal21: Der Liberalisierungsschub lässt ja auch das Bedürfnis nach sozialer Sicherung wachsen für den Fall, dass es mit dem individuellen Erfolg nicht klappt. Da würde man eigentlich erwarten, dass die Bürgerinnen und Bürger den Politikern sagen: Löst unsere sozialen Probleme, unser Leben wird in dieser liberalisierten Welt schwieriger. Nehmen Sie solche Forderungen wahr?
So etwas sehe ich nicht. Ein solcher Diskurs findet eigentlich nicht statt.
Journal21: Und auf der anderen Seite – kann man heute mit sozialpolitischen Themen bei Wahlen punkten?
Mit Sozialpolitik sind heute weniger Wähler zu gewinnen als in der Vergangenheit, weil wir in der Schweiz in der Sozialpolitik – ich verwende einen Ausdruck, der die Sache etwas überzeichnet – gewisse Apartheidstendenzen haben. Wir haben tatsächlich unter den Klienten der Sozialpolitik eine gewisse Anzahl Ausländerinnen und Ausländer, weil wir sie genau für jene Jobs in die Schweiz holen, die sozialpolitisch immer gefährdet sind. Und es sind dann auch jene, die keine Mitbestimmung haben im Land und als Sündenböcke für Probleme herhalten müssen, die sie nicht verursacht haben, und das ist dann der Apartheidsgedanke.
Es ist heute für eine Partei objektiv einfacher, Wahlen zu gewinnen, wenn sie zu Problemen, die existieren, einfach sagt: Die schaffen wir aus. Wer sich sozialpolitisch engagiert, muss auch bereit sein, in den Wahlen nicht als der grösste Sieger hervorzugehen.
Da komme ich zurück auf meine Bemerkung zu den Grünen. Wenn sie schon ein so gutes Zugpferd wie die Atompolitik haben, dann sollten sie auch die Sozialpolitik mittragen.
Ein gleicher Appell geht an die FDP. Ihr muss bewusst sein, dass sie ihre liberalen Wurzeln, das Einstehen für die Freiheit des einzelnen, gerade heute gegenüber dieser nationalistischen Bewegung nicht aufgeben darf. Wenn die Freisinnigen ihre Wurzeln abschneiden – und viele haben das bereits getan – dann können sie auch verloren gehen. Wenn eine Partei ihre Werte nicht mehr verteidigt, dann braucht es auch diese Partei nicht mehr.
Und die CVP muss bereit sein, den Grundsatz der Würde eines jeden Menschen hochzuhalten. Die Würde des Menschen ist ein ganz ursprünglich christlicher Wert, wonach jeder auf Grund seiner blossen Existenz ganz grundsätzlich zu dieser Gesellschaft dazu gehört.
Und die Sozialdemokraten sollen auf der Forderung einer sozial ausbalancierten Schweiz beharren.
Man kann den nationalistischen Tendenzen nur entgegenhalten, wenn jede Partei auf ihre Grundwerte zurückgreift und diese konsequent in die politischen Debatten einbring und umsetzt. Ein paar Slogans auf den Plakaten genügen nicht. Nur so kann man der SVP entgegenhalten.
Journal21: Wenn ich das, was Sie gesagt haben, zusammen nehme, dann heisst das: Die Wählerinnen und Wähler äussern keine sehr deutlichen sozialpolitischen Forderungen. Die Parteien können sich wenig Hoffnungen machen, mit solchen Forderungen die Wahlen zu gewinnen. Ist da zu vermuten, dass das neue Parlament in Sachen Sozialpolitik noch weniger zustande bringt?
Das ist meine Befürchtung. Und ich sage das darum so deutlich in der Hoffnung, dass diese Befürchtung vielleicht etwas weniger eintritt, wenn man sie deutlich benennt.