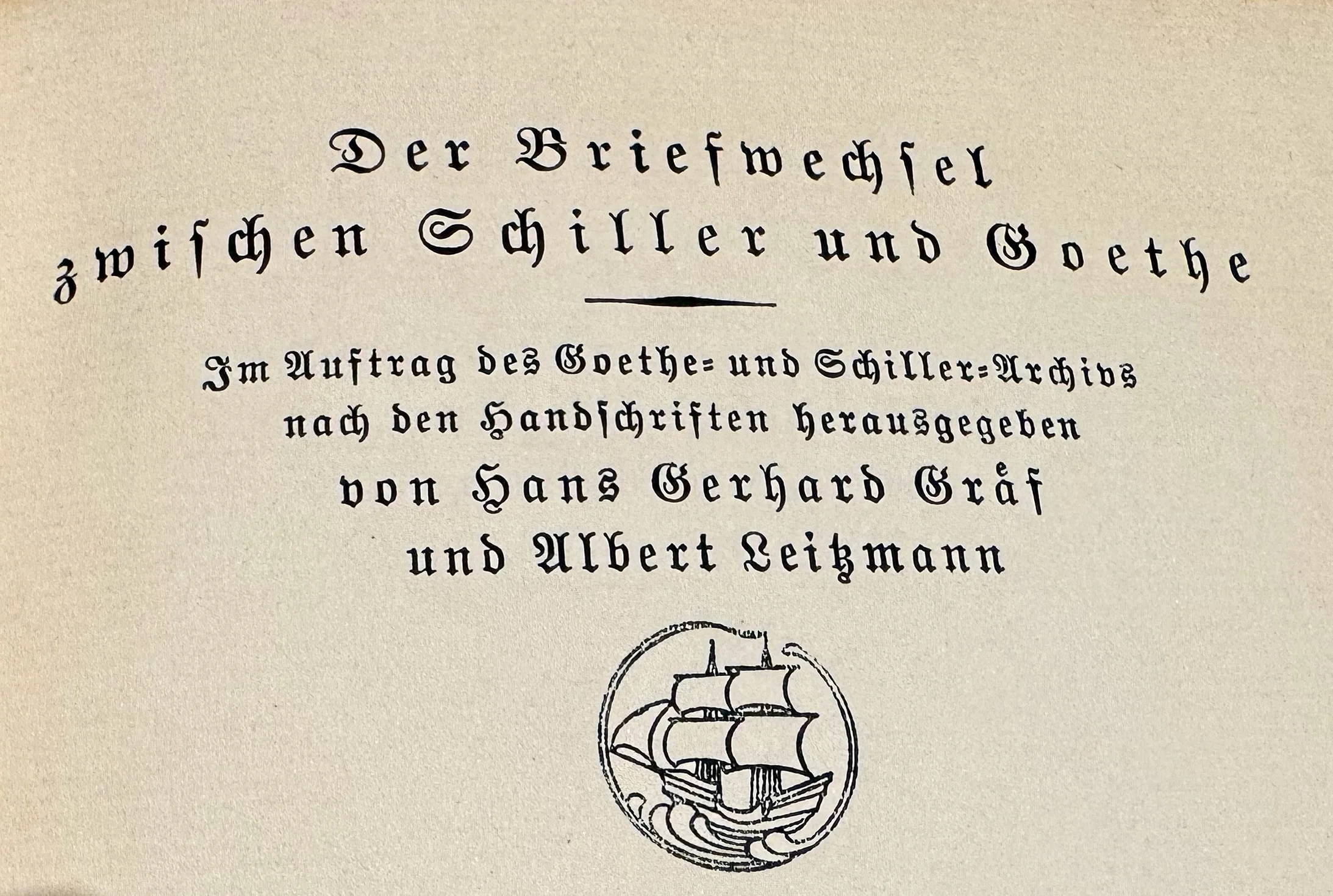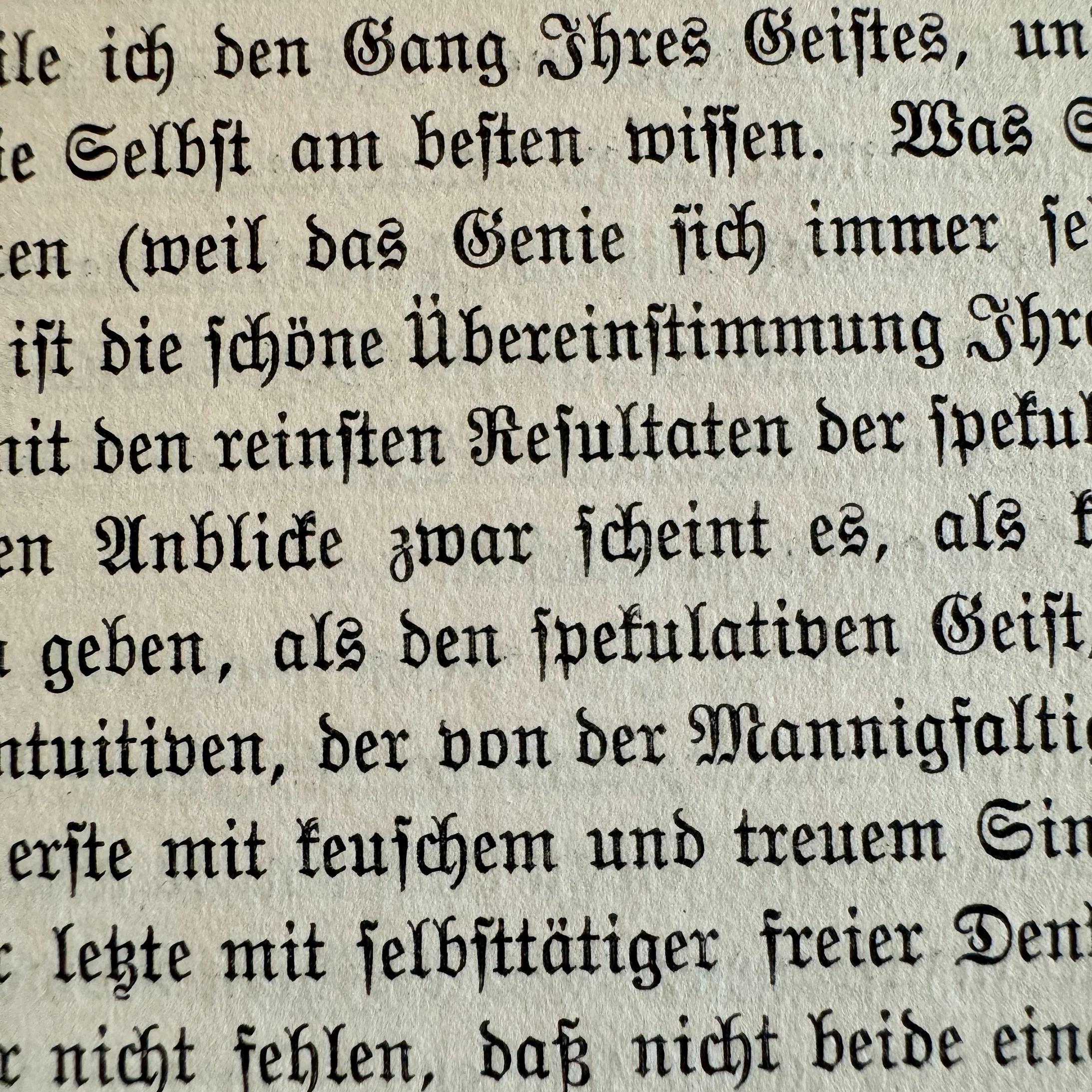In ihrem Briefwechsel tauschten Schiller und Goethe sich oft täglich aus. In einer beispiellosen Zusammenarbeit unterstützten sie einander mit Kritik, Ideen und Ermutigung. Zudem hielten sie gemeinsam einen anspruchsvollen Literatur- und Kulturbetrieb am Laufen.
Man stutzt kurz, wenn von «Auswechslung der Ideen» die Rede ist, doch fällt es dann nicht schwer, hinter dem Ausdruck den Ideenaustausch der beiden Dichter zu erkennen. Wechseln und Tauschen sind bedeutungsmässig so dicht beisammen, dass sie gegeneinander gewechselt oder getauscht werden können. Die kleine Irritation beim Lesen eines Briefs, den Goethe vor 230 Jahren geschrieben hat, kann durchaus produktiv sein, nämlich wenn sie Anlass gibt, nebst dem Inhalt auch die Sprache genauer im Auge zu behalten. Stolpermomente dieser Art sind nicht die geringste der Bereicherungen, die der Goethe-Schiller-Briefwechsel der Jahre 1794–1805 zu bieten hat. Aber da ist natürlich viel mehr und Wichtigeres.
Die Länge meines persönlichen Anmarschwegs, bis ich die berühmte Korrespondenz zu lesen begann, ist eigentlich unerklärlich. Als angehender Student der Germanistik hatte ich es für tunlich gehalten, bei der dreibändigen Ausgabe, die ich im Antiquariat entdeckte, zuzugreifen. Zuhause erhielten die neu erworbenen Bücher einen Platz neben der zwölfbändigen Goethe-Ausgabe (Birkhäuser 1944), die meine weitblickende Gotte mir in meiner Mittelschulzeit geschenkt hatte; es ist nicht lange her, dass sie mit 101 Jahren gestorben ist. Die schmalen Dünndruckbände des Birkhäuser-Goethe blieben über all die Zeit die am intensivsten gebrauchten Bücher meiner kleinen Bibliothek. Etliches habe ich drei-, vier-, fünfmal in verschiedenen Lebensaltern gelesen. Aber der nebenan eingereihte Schiller-Goethe-Briefwechsel blieb ungeöffnet – keine Ahnung, weshalb.
Antiquarisches mit lebendigem Bezug zu Weimar
Vor einem Jahr habe ich die drei kompakten Bände aus dem Schlaf geweckt – oder sie mich, wie man’s nimmt. Denn nach wenigen Seiten war mir klar, ich würde diese 1006 Briefe alle der Reihe nach lesen, und ich würde mir die Zeit nehmen, zumindest punktuell den Kommentarteil zu konsultieren und nebenher einiges zu recherchieren.
Meine antiquarische Ausgabe ist – sorgfältig ediert, gesetzt und produziert – 1912 erschienen im Insel-Verlag zu Leipzig. Von der Machart her vermutlich ein Massenprodukt, hergestellt zur Ausstaffierung bürgerlicher Bücherschränke. Dabei ist die Ausgabe mit soliden Rücken und Deckeln sowie einer bequem zu öffnenden Fadenheftung eigentlich kein blosses Repräsentationsstück, sondern ausgesprochen geeignet zum fleissigen Gebrauch durch neugierige Leser.
Die Schutzumschläge aus fast schon edel vergilbtem Pergamentpapier haben die 112 Jahre mit geringen Blessuren überstanden. Die Buchseiten sind etwas steif, nicht ganz glatt und inzwischen leicht gebräunt. In der Nahsicht ist der Druck des Bleisatzes als geringfügig erhabene Farbschicht auf der feinen horizontalen Rillenstruktur des Papiers zu erkennen; die Schrift lässt sich mit den Fingerkuppen ertasten, wenn man über die Seiten streicht. Am Ende jedes Bandes hat sich der Hersteller eingetragen mit dem Vermerk «Gedruckt in der Hofbuchdruckerei zu Weimar». Die Offizin hat übrigens kürzlich ihr 400-jähriges Bestehen gefeiert.
In der gleichen Stadt war die Schriftgiesserei des Justus Erich Walbaum ansässig. Der Inhaber war nicht nur Giesser, sondern auch Gestalter. Er kreierte neben anderen die berühmte, nach ihm benannte Type der Walbaum-Fraktur. Aus eben dieser Schriftfamilie ist meine Insel-Edition des Briefwechsels gesetzt.
Was irgend handfest ist an diesen Büchern, verweist konsequent auf Weimar. Das könnte nicht besser passen, denn um Weimar dreht sich alles in diesen Büchern: Die kleine Residenzstadt war Wirkungsort Goethes und Schillers, europaweit ausstrahlendes Zentrum der literarischen Hochklassik – und besonders auch Schauplatz und Labor der von den beiden Genies neu belebten Theaterkultur und Schauspielkunst.
Das Klassikerquartett und sein Power-Duo
Das Zusammentreffen Goethes mit Schiller in Weimar war eines der Zentralereignisse der abendländischen Kulturgeschichte. Vorbereitet wurde es indirekt durch die kluge und kunstsinnige Herzogin Anna Amalia, Regentin des Miniatur-Herzogtums Sachsen-Weimar-Eisenach. Sie hatte den aufklärerischen Schriftsteller Christoph Martin Wieland als Prinzenerzieher für ihre beiden Söhne gewonnen – und damit die Weichen für die spätere Weltgeltung ihrer kleinen Residenzstadt Weimar gestellt.
Der Ältere der beiden, Thronfolger Carl August, war nämlich ein enger Freund des nur acht Jahre älteren Goethe und holte diesen 1775 als seinen Berater nach Weimar, wo der Dichter mehr und mehr auch wichtige Staatsämter versah. Nachdem es Goethe und Wieland gelungen war, Johann Gottfried Herder 1776 nach Weimar zu holen, war das berühmte Viergespann der Weimarer Klassik fast komplett. Es fehlte noch Schiller. Goethe sah in dem jungen Star zuerst einen Konkurrenten beim Wettbewerb um die vorherrschende Position in der deutschen Literatur. Zudem erinnerte ihn der jugendliche Feuerkopf unangenehm an seine eigene abgelegte Sturm-und-Drang-Zeit.
Eine erste, von Charlotte von Lengefeld, Schillers späterer Frau, arrangierte Begegnung Goethes mit Schiller war frostig geblieben. 1794 zog Letzterer mit seiner Familie nach Jena, wo er an der Universität eine Professur für Geschichte antrat. Seine Antrittsvorlesung mit dem Titel «Was heisst und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?» geriet zum überbordenden Pop-Ereignis, das den universitären Rahmen genauso sprengte, wie die Aufführung seines Dramas «Die Räuber» zwölf Jahre zuvor im Mainzer Theater Furore gemacht hatte.
Nun waren sie also in und bei Weimar vereint: Wieland, Goethe, Herder und Schiller, der erst später mit Familie von Jena nach Weimar zog. Dauerhaft wirkmächtig war von dem Quartett einzig die Arbeitsgemeinschaft und Freundschaft zwischen Goethe und Schiller; diese dafür in einem für die Kulturgeschichte wohl einzigartigen Ausmass.
Begegnung mit unabsehbaren Wirkungen
1794 gründete der Geschichtsprofessor und rastlose Schriftsteller Schiller (1759–1805) die monatliche Kulturzeitschrift «Die Horen», ein ambitioniertes Projekt, für das er als Herausgeber, Chefredaktor, Produzent, Marketingleiter und Finanzchef in Personalunion manchmal fast Tag und Nacht schuftete. Eine Vielzahl solcher Zeitschriften warb zu jener Zeit um die Gunst des gebildeten Publikums; die meisten hielten nur wenige Jahre durch. Auch «Die Horen» kam nicht über drei Jahrgänge hinaus, doch die Zeitschrift war einflussreich und galt als prägend für ihren Typus.
Am 13. Juni 1794 schrieb Schiller erstmals an Goethe (1749–1832). Er redete ihn an als «Hochwohlgeborener Herr, hochzuverehrender Herr Geheimer Rat» und bat ihn um Mitarbeit bei den «Horen». Goethe antwortete am 24. Juni zustimmend, aber noch mit einer kühlen Distanz. Am 25. Juli dann, in Goethes zweitem Schreiben, ein veränderter Ton: «Erhalten Sie mir ein freundschaftliches Andenken und sein Sie versichert, dass ich mich auf eine öftere Auswechslung der Ideen mit Ihnen recht lebhaft freue.»
Dem Brief war ein persönliches Treffen bei Wilhelm von Humboldt in Jena vorausgegangen. Humboldts Tagebuch meldet vom 22. Juli: «Am Abend sassen Schiller und Goethe bei uns.» Goethe stellte dort gemäss eigenen Aufzeichnungen seine Theorie einer Urpflanze vor. Schiller erwähnte später dem gemeinsamen Freund Körner gegenüber, man habe bei Humboldt über Kunst und Kunsttheorie debattiert. Der Abend blieb den Beteiligten in Erinnerung als denkwürdiger Anfang der Freundschaft zwischen Schiller und Goethe.
Am 4. September 1794 schlug Goethe ein längeres Treffen bei ihm in Weimar vor, das kurz darauf, zwischen dem 14. und dem 29. September, zustande kam. Sie wollten einander kennenlernen, sich Zeit nehmen für ausgiebige Gespräche: über Literatur und Theater, über Schillers an Kant orientierte Philosophie, über Goethes auf einem breiten Erfahrungsbegriff basierende Naturforschungen und natürlich über die «Horen», die sie von nun an als gemeinsames Projekt betrachteten.
Literarische Werkstatt per Brief
Manchmal gingen die Briefe täglich zwischen Jena und Weimar hin und her. Die Strasse zwischen den beiden nur zwanzig Kilometer voneinander entfernten Städten war seit 1787 als Chaussee ausgebaut. Eine regelmässige Verbindung mit Postkutschen diente dem Transport von Personen, Briefen und Paketen. Eilige Sendungen übergab man besser der reitenden Post. Oft ist in den Briefen von Botenmädchen oder -frauen die Rede. Das Überbringen von Postsachen war eine beliebte private Verdienstmöglichkeit und offenkundig zwischen den beiden wichtigsten Städten des Herzogtums besonders lukrativ. Nur mit der Zuverlässigkeit scheint es manchmal gehapert zu haben.
Goethe wie auch Schiller pflegten Briefe, sofern es nicht kurze Billetts waren, schriftlich zu entwerfen und gründlich zu überarbeiten. Danach diktierten sie jeweils den definitiven Brieftext einem angestellten Schreiber. Was man zugesandt bekam, war daher wohlüberlegt und in eine gültige Form gegossen. Dies erklärt auch den Umstand, dass Briefe nicht nur sorgfältig – fast wie die teuren Bücher – verwahrt wurden; je nach Inhalt wurden sie auch abgeschrieben oder ausgeliehen und dadurch weiteren Personen zugänglich gemacht.
In die Anfangszeit der Schiller-Goethe-Korrespondenz fiel Goethes Ausarbeitung seines Romans «Wilhelm Meisters Lehrjahre». Schiller las gewissermassen mit und begleitete die Entstehung des ihn begeisternden Werks über viele Stufen hinweg mit scharfsinniger Kritik. Goethe erkannte, welch genialen Lektor er in seinem Freund hatte. Er bat ihn regelmässig um kritische Rückmeldungen und antwortete auch immer wieder – zustimmend oder die Diskussion suchend – direkt auf solche Feedbacks. Im Juli 1796 herrschte in der auf dem Korrespondenzweg betriebenen literarischen Werkstatt zu «Wilhelm Meister» Hochbetrieb: In acht, in der Edition jeweils mehrere Druckseiten langen Briefen kommunizierten die in Weimar und Jena sitzenden Workshop-Teilnehmer. Goethe bemerkte am 5. Juli, Schillers Briefe seien für ihn «Stimmen aus einer anderen Welt, auf die ich nur horchen kann».
«Teilnahme an dem, was wir lieben und treiben»
Aus solchen Kooperationen erwuchs die Freundschaft der beiden. Zum Jahresbeginn 1795 schrieb Schiller: «Meine besten Wünsche zu dem neuen Jahre und noch einen herzlichen Dank für das verflossene, das mir durch Ihre Freundschaft vor allen übrigen ausgezeichnet und unvergesslich ist.» Schon am nächsten Tag antwortete Goethe: «Viel Glück zum neuen Jahre. Lassen Sie uns dieses zubringen, wie wir das vorige geendigt haben, mit wechselseitiger Teilnahme an dem, was wir lieben und treiben. Wenn sich die Gleichgesinnten nicht anfassen, was soll aus der Gesellschaft und der Geselligkeit werden. Ich freue mich in der Hoffnung, dass Einwirkung und Vertrauen sich zwischen uns immer vermehren werden.»
Von solcher Vertrauen schaffender «Einwirkung» konnte in der Folge auch Schillers Dramen-Trilogie «Wallenstein» in hohem Mass und über sehr lange Zeit profitieren. Das Riesenprojekt mit dem historischen Stoff aus der Zeit des Dreissigjährigen Kriegs trieb den Dichter oft zur Verzweiflung. Goethe begleitete den Schaffensprozess, las Entwürfe unterschiedlichen Reifegrads, machte Vorschläge zu Aufbau und Details und nahm sich dafür auch dann Zeit, wenn er selbst mit übermässig vielen Verpflichtungen und stagnierenden eigenen Schreibvorhaben kämpfte. Von Goethe kam auch die entscheidende Idee, den anfangs in Prosa gefassten Stoff in Verse umzugiessen – für Schiller ein enorm fruchtbarer Rat, der ihn regelrecht befreite.
Umgekehrt war es Schiller, der Goethe wiederholt drängte, die zunächst zögerliche Wiederaufnahme der Arbeit am liegen gebliebenen «Faust» energisch voranzutreiben. Ohne ihn wäre das 1797 fertiggestellte Stück (Faust. Eine Tragödie – später als Faust I bezeichnet) wahrscheinlich ein Torso geblieben. Im Brief vom 9. Dezember 1797 gab Goethe zu erkennen, weshalb er immer wieder vor dem Faust-Stoff zurückgeschreckt war: «Ich kenne mich zwar nicht selbst genug, um zu wissen, ob ich eine wahre Tragödie schreiben könnte, ich erschrecke aber bloss vor dem Unternehmen und bin beinahe überzeugt, dass ich mich durch den blossen Versuch zerstören könnte.»
Wie Schiller darauf reagierte, ist schlicht grossartig. Er schrieb dem Freund am 12. Dezember 1797: «Sollte es wirklich an dem sein, dass die Tragödie, ihrer pathetischen Gewalt wegen, Ihrer Natur nicht zusagt? In allen Ihren Dichtungen finde ich die ganze tragische Gewalt und Tiefe, wie sie zu einem vollkommenen Trauerspiel hinreichen würde, im «Wilhelm Meister» liegt, was die Empfindung betrifft, mehr als eine Tragödie; ich glaube, dass bloss die strenge gerade Linie, nach welcher der tragische Poet fortschreiten muss, Ihrer Natur nicht zusagt. (…) Eine gewisse Berechnung auf den Zuschauer, von der sich der tragische Poet nicht dispensieren kann, (…) geniert Sie, und vielleicht sind Sie gerade nur deswegen weniger zum Tragödiendichter geeignet, weil Sie so ganz zum Dichter in seiner generischen Bedeutung erschaffen sind.»
Spöttereien und freundschaftlicher Wettstreit
Doch die beiden Genies konnten auch anders. Die «Xenien», welche sie gemeinsam in Schillers «Musenalmanach» – die jährliche Gedichtsammlung verschiedener Autoren war ein weiteres seiner editorischen Projekte – als Spottgedichte auf Literaten und den Literaturbetrieb veröffentlichten, schlugen in der Szene mächtig ein. Schiller und Goethe spornten einander an zu immer neuen fiesen Distichen. Als sich die Getroffenen mit publizierten Retourkutschen zur Wehr setzten, konnte sich das verschworene Duo an den augenscheinlichen Mühen ihrer Gegner mit der schwierigen Versform gütlich tun.
In freundschaftlichen Wettstreit traten Schiller und Goethe, indem sie im Rahmen einer eigentlichen Literatur-Factory eine Serie von Balladen dichteten und sich dabei auch intensiv über diese spezielle Gedichtform Gedanken machten. In dem als Balladenjahr 1797 in die Literaturgeschichte eingegangenen Projekt entstanden so berühmte Gedichte wie «Der Zauberlehrling», «Die Braut von Korinth», «Der Taucher», «Der Handschuh» und «Die Kraniche des Ibykus». Diese Juwelen der klassischen deutschen Verskunst erschienen ebenfalls im «Musenalmanach».
Die tausend Briefe geben nebenbei auch viele Einblicke in den Alltag der beiden Dichter. Da sie beide über Deutschland hinaus als Berühmtheiten bekannt waren, kamen ständig Besucher, die oft weither gereist waren und auf mindestens ein paar Stunden des Gesprächs mit ihren Idolen Anspruch machen wollten. Sie mussten bewirtet, angehört und an weitere Stationen ihrer Bildungsreisen empfohlen werden. Zudem wollte das grosse Netz von Freund- und Bekanntschaften gepflegt sein mit gegenseitigen Besuchen und häufig ausgetauschten Briefen. Schiller kämpfte permanent um die nötige Ruhe fürs Schreiben. Ausserdem war er oft kränklich oder ernsthaft krank; seine fragile Konstitution brachte ihn rasch ans Limit.
Goethe war die vitalere Natur. Was ihn oft in der schriftstellerischen Kreativität lahmlegte, waren weniger gesundheitliche als emotionale Störungen. Man würde heute vielleicht von depressiven Verstimmungen reden. Da klagte er dann, «in keiner poetischen Stimmung» zu sein. Seine überbordenden Verpflichtungen als weimarischer Minister hatte er nach der Italienreise mit gnädiger Zustimmung seines Fürsten zwar reduzieren können, doch er stand noch immer in dessen Pflicht. Carl August brauchte nur zu winken, und Goethe musste sogleich bei ihm auf der Matte stehen.
Hotspot einer neuen Theaterkultur
Wichtigste Aufgabe Goethes im Herzogtum war ab den späten 1790er Jahren die Qualitätsentwicklung und Leitung des Weimarer Hoftheaters, eines Mehrspartenhauses mit eigenem Ensemble. Auch hier war die Zusammenarbeit mit Schiller intensiv. Sie verlief in selbstverständlicher Art auf Augenhöhe; man könnte von einer gemeinsamen Intendanz reden. Die beiden verfolgten das Ziel, das Haus in der kleinen Stadt Weimar zum Hotspot einer neuen Theaterkultur zu machen. Die künstlerischen Möglichkeiten des klassischen Schauspiels sollten in allen Dimensionen erprobt und modellhaft entwickelt werden. Man wollte mit den besten Schauspielerinnen und Schauspielern arbeiten, und zwar so, dass sich ein neuer professioneller Standard der Schauspielkunst herausbilden konnte. 1803 fasste Goethe die aus der Praxis gewonnenen Einsichten zusammen in den «Regeln für Schauspieler». Schauspielerei war bislang als eine Art Budenzauber betrachtet und wenig ernst genommen worden. Nun wurden die in dem Beruf Tätigen als Künstlerinnen und Künstler wertgeschätzt.
Die Co-Intendanten verfolgten mit Spielplangestaltung, Einbezug der Autoren, Personalpolitik, Ausbildung und gründlicher Probenarbeit eine ehrgeizige kulturpolitische Agenda. Durch eine qualitative Entwicklung des Angebots hofften Goethe und Schiller auch den Geschmack des Publikums zu bilden. Dass dieses in seiner Mehrzahl die leichte Kost am meisten liebte, wurde akzeptiert und in der Programmgestaltung berücksichtigt. Mit jährlich fast 300 Aufführungen aller Sparten konnte das Haus ein breites und vielseitiges Angebot präsentieren.
Selbstverständlich brachten Schiller und Goethe auch ihre eigenen Stücke in Weimar auf die Bühne – aber in der Regel nicht die eigenen, sondern die des Freundes. So betreute Goethe beispielsweise 1798 die Inszenierung der «Wallenstein»-Uraufführung, und 1802 stellte Schiller eine von ihm bearbeitete Fassung von «Iphigenie auf Tauris» vor.
Ein ungleiches Freundespaar
Wie war eine so harmonische Arbeitsbeziehung zwischen Schiller und Goethe, zwei Top-Stars ihrer Zeit, über so lange Zeit überhaupt möglich? Sie waren verschiedene Charaktere und standen sich in ihrer geistigen Orientierung keineswegs sehr nahe. Schiller ein hochmoralischer Idealist, Goethe ein lebenskluger Realist, Schiller ein Theoretiker mit einem Hang zum rigorosen Systematisieren, Goethe ein Empiriker mit der Bereitschaft zum Akzeptieren von Widersprüchlichem. Wie geht das zusammen?
Eine Episode der Korrespondenz von März/April 1801 zeigt, wie und weshalb es funktionierte zwischen den beiden. Schiller war eben dabei, seinen Wohnort definitiv von Jena nach Weimar zu verlegen, und zog Bilanz, was ihm die Jahre in Jena gebracht hätten. Das klingt dann so: «Ich habe also zwar nichts in der Lotterie gewonnen, habe aber doch meinen ganzen Einsatz wieder.»
Ein Nullsummenspiel! Schiller war ernüchtert. Doch dann versuchte er einen Gedanken weiterzuspinnen, den er aus einem Gespräch über Kunst mit dem Philosophen Friedrich Schelling mitgenommen hatte. Jedes Kunstwerk brauche eine «Totalidee», die durch die Poesie zum Objekt und dadurch mitteilbar werde. Der wahre Poet schöpfe seine Kraft zur Belebung der künstlerischen Objekte aus dem Ideellen, und er drücke daher als der «vollkommene Dichter» «das Ganze der Menschheit» aus. – Schiller at his best: Der Gedanke kann ihm nicht hoch genug fliegen. Und im Zusammenhang seiner Situation sieht es danach aus, als habe er sich mit einem kühnen literaturtheoretischen Wurf selbst über die lebensgeschichtliche Ernüchterung hinweghelfen wollen.
Diese Attitüde musste Goethe verdächtig, wenn nicht gar zuwider sein. Wie würde er reagieren? Zuerst schildert er sein Befinden anlässlich eines Aufenthalts auf dem Land mit folgenden Worten: «Mein hiesiger Aufenthalt bekommt mir sehr gut, teils weil ich den ganzen Tag mich in freier Luft bewege, teils weil ich durch die gemeinen Gegenstände des Lebens depotenziiert werde, wodurch eine gewisse Bequemlichkeit und Gleichgültigkeit in meinen Zustand kommt, die ich lange nicht mehr kannte.» Zwischen den Zeilen raunt es: «Entspann dich!» Goethe empfiehlt eine «Depotenziierung» mittels einer Dosis Alltag und einem tiefen Atemzug Natur.
Dann erst geht er auf Schillers hochgestochene Poetologie ein: «Was die Fragen betrifft, die Ihr letzter Brief enthält, bin ich nicht allein Ihrer Meinung, sondern ich gehe noch weiter. Ich glaube, dass alles, was das Genie, als Genie, tut, unbewusst geschehe.» Und weiter: «Was die grossen Anforderungen betrifft, die man jetzt an den Dichter macht, so glaube ich auch, dass sie nicht leicht einen Dichter hervorbringen werden. Die Dichtkunst verlangt ein Subjekt, das sie ausüben soll, eine gewisse gutmütige, ins Reale verliebte Beschränktheit, hinter welcher das Absolute verborgen liegt. Die Forderungen von oben zerstören jenen unschuldigen produktiven Zustand und setzen, für lauter Poesie, an die Stelle der Poesie etwas, das nun ein für allemal nicht Poesie ist. (…) Dies ist mein Glaubensbekenntnis, welches übrigens keine weitere Ansprüche macht.»
Goethe gibt Schillers Theorie Recht, aber nur, um sie gleichzeitig zu überbieten und zu entlarven. Kern seiner Auffassung von Dichtkunst ist die «ins Reale verliebte Beschränktheit», die positiv akzeptierte Limitierung des Künstlers selbst und seiner Wahrnehmungsfähigkeit, «hinter der das Absolute verborgen liegt», die also jene von Schiller postulierte Totalität quasi inkognito und anonym enthält. Goethe fängt Schillers grosse Geste, die ins Leere greift, mit einer Wendung zum Realen auf. Und er tut es nicht, um den Freund mit einem Placebo zu beruhigen, vielmehr ist es ihm ernst: «Dies ist mein Glaubensbekenntnis». Aber nicht bitter ernst, deshalb: «keine weiteren Ansprüche».
Das Geheimnis der Harmonie
In solcher Art «Auswechslungen der Ideen» lag das Geheimnis der viele Jahre währenden Harmonie der Grundverschiedenen. Die beiden waren sich ihrer Gegensätze bewusst und akzeptierten die jeweils andere geistig-emotionale Kostümierung des Vis-à-vis. In einem nicht zu erschütternden Zutrauen in die Fruchtbarkeit der «Auswechslungen» zwischen ihnen pflegten sie eine unbefangene Offenheit, mit der sie einander ihre Probleme vorlegten, und zwar Arbeit wie auch Stimmungen betreffend. Hinzu kam beiderseits eine hohe Sensibilität für Takt: Ihre Kritik verletzte nie, war aber auch nie in Watte gepackt, als hätte sie dem Adressaten keinen souveränen Umgang mit Einwänden zugetraut.
Taktvoll gehen sie auch mit ihrer Beziehung als solcher um. Es fehlt nicht an wechselseitigen Bezeugungen, wie sehr sie einander brauchen und auch mögen – aber man vermeidet jede Exaltierung. Die einleitende Bemerkung in Goethes Brief vom 26. Juni 1799 markierte schon die Grenze der von den Freunden gerade noch tolerierten Emotionalität: «Ich habe heute keinen Brief von Ihnen erhalten und mich deshalb kaum überzeugen können, dass es Mittwoch sei.»
«Ganz verteufelt human»
Wie sehr Goethe und Schiller einander vertraut haben, liesse sich an vielen Momenten ihrer Zusammenarbeit zeigen. Hier ein letztes Beispiel. Goethe hatte lange an seinem Schauspiel «Iphigenie auf Tauris» gearbeitet. 1779 wurde es in Prosa uraufgeführt, dann – mit Unterstützung durch Wieland – in Verse gefasst. Doch Goethe äusserte sich sarkastisch über sein Drama: Es sei «ganz verteufelt human». An Schiller schrieb er: «Mit der Iphigenie ist mir unmöglich etwas anzufangen.» Als er von Schiller efuhr, wie sehr dieser das Drama schätzte und was er zu ändern vorschlug, war Goethe hocherfreut: «Könnten und möchten Sie das Stück zur Aufführung treiben, ohne dass ich eine Probe sähe, und es Sonnabend den 15ten geben?»
Schiller übernahm den ungewöhnlichen Auftrag und griff, wie er es brieflich am 22. Januar 1802 gegenüber Goethe skizziert hatte, sehr stark in das Stück ein. Er kürzte vehement, veränderte einzelne Figuren, begrenzte das Moralische, hob das Historische und Mythische hervor und verdeutlichte den besonderen Charakter dieses Dramas: Die Handlung bleibt quasi «hinter den Kulissen», die «Gesinnung» wird zur Handlung gemacht.
Das Ende dieser unvergleichlich produktiven Arbeitsgemeinschaft kam plötzlich und unangekündigt. Jedenfalls war weder Schiller als ausgebildeter Arzt noch der naturverbundene Goethe in der Lage gewesen, die durchaus vorhandenen Vorzeichen zu deuten. Schiller starb am 9. Mai 1805 nach zwei Zusammenbrüchen im Alter von 46 Jahren. Die Autopsie ergab, dass er an Tuberkulose gelitten hatte. Goethe, zu dem Zeitpunkt selbst gerade erst von einer Erkrankung genesen, berichtet in den Annalen von 1805 folgendes: «Anfangs Mai wagt’ ich mich aus: ich fand ihn im Begriff ins Schauspiel zu gehen, wovon ich ihn nicht abhalten wollte. Ein Missbehagen hinderte mich ihn zu begleiten und so schieden wir vor seiner Haustüre, um uns niemals wieder zu sehen.»