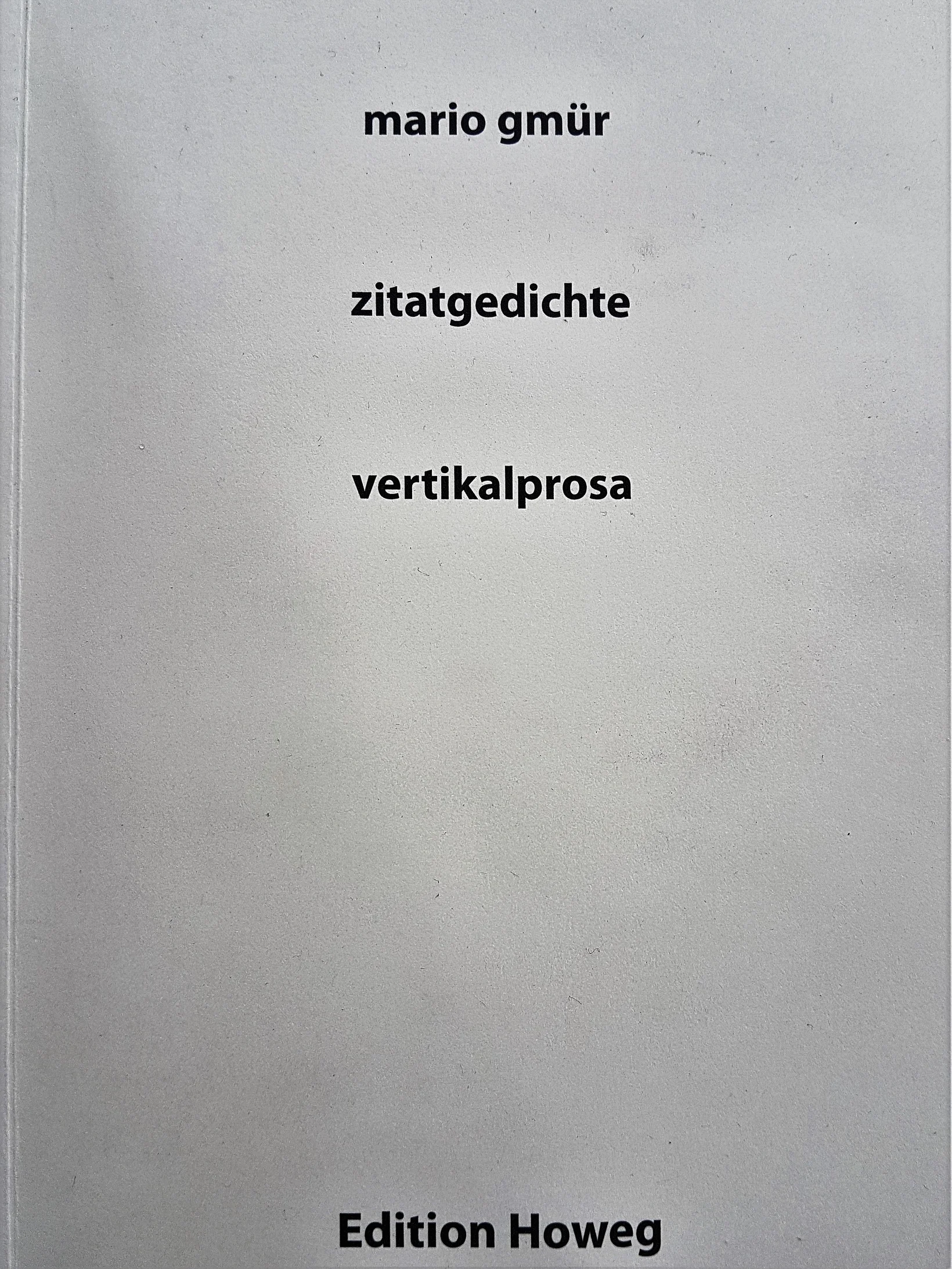Als Journalist und Autor, der man ist, hat man sich irgendeinen Ruf erworben. Den, Lyriker zu sein, eher nicht. Wer das insgeheim bedauert, dem helfen Komplimente von Freunden oder Freundinnen – wie: „Ich habe da was von dir gelesen, das hatte was Poetisches“ – nur wenig. Die Halbwertszeit des Geschmeicheltseins ist überschaubar!
Da ergeht es Kolleginnen und Kollegen, deren Texte der Zürcher Autor Mario Gmür nicht nur gelesen, sondern auch für gut befunden hat, besser. Sie sind in seinem Buch „zitatgedichte / vertikalprosa“ auszugsweise präsentiert. Nicht als Zitate, sondern verkürzt und neu gesetzt, als Gedichte.
Poésie automatique im Café Sprüngli
Mario Gmür im Klappentext seines Werks: „Bei der täglichen Zeitungslektüre offenbarte sich mir an gewissen Stellen eine Art von poésie automatique.“ Und diese Offenbarung weckte seine Neugierde. Also durchforstete der leidenschaftliche und gewiss anspruchsvolle Leser in seiner freien Zeit oder in den Ferien (wo er vorzugsweise Bücher verschlingt) Leitartikel, Gerichtsberichte, wissenschaftliche Beiträge, Feuilleton-Rezensionen, politische Aufsätze, Ausland-Reportagen, ja sogar Sport-Kommentare.
Sobald ihn bei der Lektüre eine Textpassage „angefallen“ hat oder ihm für eine Nachbetrachtung lohnend erschien, wurde sie markiert. Wichtig waren Gmür dabei überraschende Pointen oder die Vorahnung, dass sich aus dem Exzerpt etwas machen liesse, das sich zu etwas anderem wandeln, eine unerwartete Wendung nehmen könnte.
Für die Suche nach entsprechenden Texten setzte sich Gmür oft ins Café Sprüngli am Zürcher Paradeplatz. Dort ist es in den Vormittagsstunden eher ruhig und das umsichtige Servicepersonal hat ein Gespür für Geistesarbeiter, die es etwas „heimelig“ wünschen. Zudem war Gmür dort – ganz wichtig – keiner permanenten Background-Musikbeschallung ausgesetzt wie in irgendeiner Bar.
Facettenreicher Autor
Mario Gmür ist ein Autor mit vielen Facetten. Fachliterarisch hat er etwa den Titel „Der öffentliche Mensch“ (2002) publiziert. Und im belletristischen Bereich schildert er in „Meine Mutter weinte, als Stalin starb“ (2013) Erlebnisse seiner jüdisch-kommunistischen Mama im Zürich der 1950er-Jahre. Hinzuweisen ist auch auf die umsichtige Herausgabe von unveröffentlichten Romanen seines Vaters Harry Gmür: „Am Stammtisch der Rebellen“ (2015) – für sozial- und kulturgeschichtlich interessierte Stadtzürcher fast schon eine Pflichtlektüre – und „Liebe und Tod in Leipzig“ (2016).
Zum Lyrischen hat Mario Gmür eine lange Beziehung. In jungen Jahren lernte er „leichtverständliche“ Gedichte wie etwa „Der römische Brunnen“ von Conrad-Ferdinand Meyer (1882) oder „Aufm Zürichersee“ (1775) von Johann Wolfgang von Goethe auswendig. Sie waren ihm so etwas wie ein geistiger Notvorrat, „falls ich zum Beispiel einmal irgendwo eingesperrt wäre und nichts zum Lesen hätte“. In den letzten Jahren hat er sich auch dem Schüttelreim gewidmet, in den Bänden „Buchstäblich versaut – 1000 philosophisch-vergammelte Schüttelreime“ (2009) sowie „Tanz der Konsonanten – Der Dreh zum Schüttelreim“ (2010).
Tranströmer, Reich-Ranicki, von Matt
Gegenwarts-Dichtkunst begeisterte ihn 2011, als Tomas Gösta Tranströmer (1931–2015) den Literatur-Nobelpreis erhielt. Mario Gmür vertiefte sich ins Werk des Schweden und wollte darüber hinaus mehr über die Theorie des Poetischen erfahren. Beim deutschen Grosskritiker Marcel Reich-Ranicki (1920–2013) fand er Erhellendes, etwa in dessen kernigen Einlassungen zum Heinrich-Heine-Poem „Ein Jüngling liebt ein Mädchen“. Und ebenso im Band „Was ist ein Gedicht“ (2017) des Schweizers Peter von Matt, für den Gmür „grösste Bewunderung“ hegt.
Als die Idee reifte, selber Lyrisches zu verfassen, konsultierte Mario Gmür einen befreundeten Gymnasiallehrer und Lyrik-Experten. Er fragte ihn, was denn überhaupt ein gutes modernes Gedicht ausmache. Die Antwort war so knapp wie apodiktisch: Ein Gedicht wird heutzutage allein durch den Zeilensprung definiert.
So weit, so gut. Mario Gmür machte sich an die Selektion und die kreative Umgestaltung seiner Sammlung von Exzerpten aus Zeitungsartikeln. Er liess sie textlich unverändert, schrieb aber alles klein, eliminierte sämtliche Interpunktionen und wagte eigene Zeilensprünge. Dann stellte er die Textbausteine vertikal auf, betitelte sie neu. Et voilà, die Gedichte waren da. Meist kurz bis mittellang.
der trainer
er fuchtelte nicht mehr wild
mit den händen wie sonst immer
gab keine wilden anweisungen mehr
sondern war erstarrt
stand meistens nur noch
in einer ecke seines reviers
am spielfeldrand
ein gebrochnener mann
er sah das 0:3
Galerie der Dichtkunst
Im Klappentext schreib Mario Gmür: „Und es bereitet mir Spass, mehr als zweihundert Journalistinnen und Journalisten heimlich in die Galerie der Dichtkunst gehoben zu haben.“ Notabene ohne dass er die Autoren der Prosatexte vorher um Erlaubnis gefragt hätte. Betupft sein wird deswegen kaum jemand, weil Gmür mit „Journalistinnen und Journalisten“ ja nicht Hinzens und Kunzens der Schreiberzunft meint. Der überwiegende Teil der Poems wurzelt schliesslich in Beiträgen aus der „NZZ“ oder dem „Tages-Anzeiger“ von Autorinnen und Autoren wie Brigitte Hürlimann, Roman Bucheli, Urs Bühler, Jürg Zbinden, Martin Ebel, Constantin Seibt, Martin Halter und anderen mehr. Der Nachweis für gutdurchdachtes, sinnhaltig-verdichtetes Schreiben ist damit geliefert.
Fans
wer ist beliebter
bart oder wurst
man glaubt bald mehr
bartträger als wurstverzehrer
zu beobachten
wie dem auch sei
fans aus ganz europa
verzehren sich in liebe
zur bärtigen wurst
Tiefer schürfen
Im Begleittext merkt Mario Gmür an, für ihn seien diese Prosatexte Gedichte, „weil sie das gewisse Etwas haben, von dem man nicht so recht weiss, was es ist“. Stellt man nun diese besondere Lyrik den Originalartikeln gegenüber, wird deutlich, dass die Bearbeitung Zusätzliches zu Tage gefördert hat.
Denkbar, dass sich Mario Gmür, der von Berufes wegen seinen Klienten tief in die Seele hineinblickt, um dort Dinge zu suchen und zu finden, die sich unsereins wohl nicht mal vorstellen möchte, einen Spass erlaubt hat: Auch mal in Zeitungstexten tiefer zu schürfen, als man es als gemeiner Leser tut.
buh
ein kollege hält einen für
gut
ein anderer für
miserabel
kritiker missbrauchen einen
um sich zu profilieren
zu positionieren
und das publikum
eine herde die bald blökt bald
buht
Das kleinste Humortaugliche
Wieviel Mario Gmür steckt eigentlich in „zitatgedichte / vertikalprosa“? Ob es klug ist, ausgerechnet einem Psychotherapeuten diese Frage zu stellen, darüber liesse sich diskutieren. Item, Gmür hat beim launigen Apero im Zürcher Odeon am Bellevue – wo man ihn oft antrifft – eine Antwort parat: „Ich mag Witz und Humor. Auf beides kann ich nur schwer verzichten. Und ich denke, ich erkenne das kleinste Humortaugliche.“
Dass dem so ist, wird bei der Lektüre klar. Und wer sich schon auf einen Diskurs mit dem passionierten Causeur über dieses, jenes und anderes eingelassen hat, findet obiges Zitat vollauf bestätigt.
keine erhebung
nuon chea bleibt im rollstuhl
der richter fordert
erheben sie sich
aber der alte rührt sich nicht
Quellensuche
Auch gedächtnisstarke Zeitungs-Vielleser werden anhand von Gmürs Gedichtkompositionen die Original-Textvorlagen kaum abrufen können. Gut, dass einem der beigefügte Quellenindex weiterhilft. Vieles ist in Internet-Suchmaschinen aufspürbar, einiges nur im klassischen Print-Archiv zu finden. Dort tauchen dann die ganzen Artikel so auf, wie sie vom Korrektorat abgesegnet und vom Layouter gestaltet in der gedruckten Zeitung erschienen sind; mit Grossschreibung, Interpunktion, Originaltiteln.
Im träfen Kürzest-Vorwort zum Buch schreibt der Schriftsteller Klaus Merz: „So lüpfig und auf wohltuende Art retardierend könnte auch unsere Zeitungslektüre wieder werden, folgten wir beim Lesen nur ab und zu Mario Gmürs vertikalen Abzweigungen und Hakenschlägen in eigener Regie. Denn ganz unverhofft wird da die ‚buchstäbliche‘ Abnützung unserer alltäglichen Wahrnehmung wieder rückgängig gemacht, unser Blick geschärft. Für Leid. Und Freud.“
Egal ob man „zitatgedichte / vertikalprosa“ von vorne bis hinten liest oder en passant darin herumschnüffelt: Mario Gmürs Lyrik mit Texten aus fremden Federn ist ein Pläsir.
das ende
schon louis pasteur sagte
die mikroben werden
das letzte wort haben
Quellen der zitierten Gedichte:
der trainer: 30.4.2014/40/TA/fredy wettstein
fans: 2.2.2015/16/NZZ/jürg zbinden
buh: 13.8.2014/19NZZ/ueli bernays
keine erhebung: 8.8.2014/6/TA/arne perras
das ende: 6.11.2014/49/NZZ/gottfried schatz
Zum Buch:
mario gmür: zitatgedichte / vertikalprosa,
mit einem Vorwort von Klaus Merz.
175 Seiten, broschiert, 14 x 21 cm
CHF 28.- / € 28.-
ISBN 978-3-85736-322-1