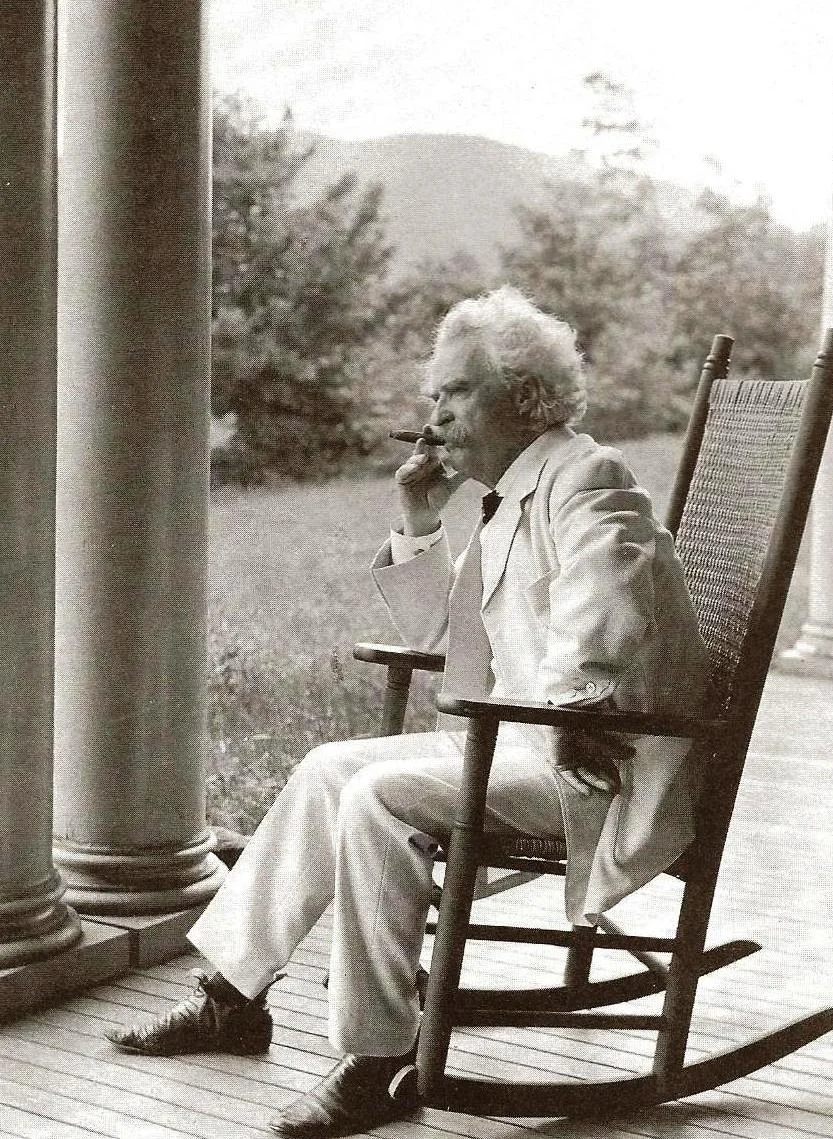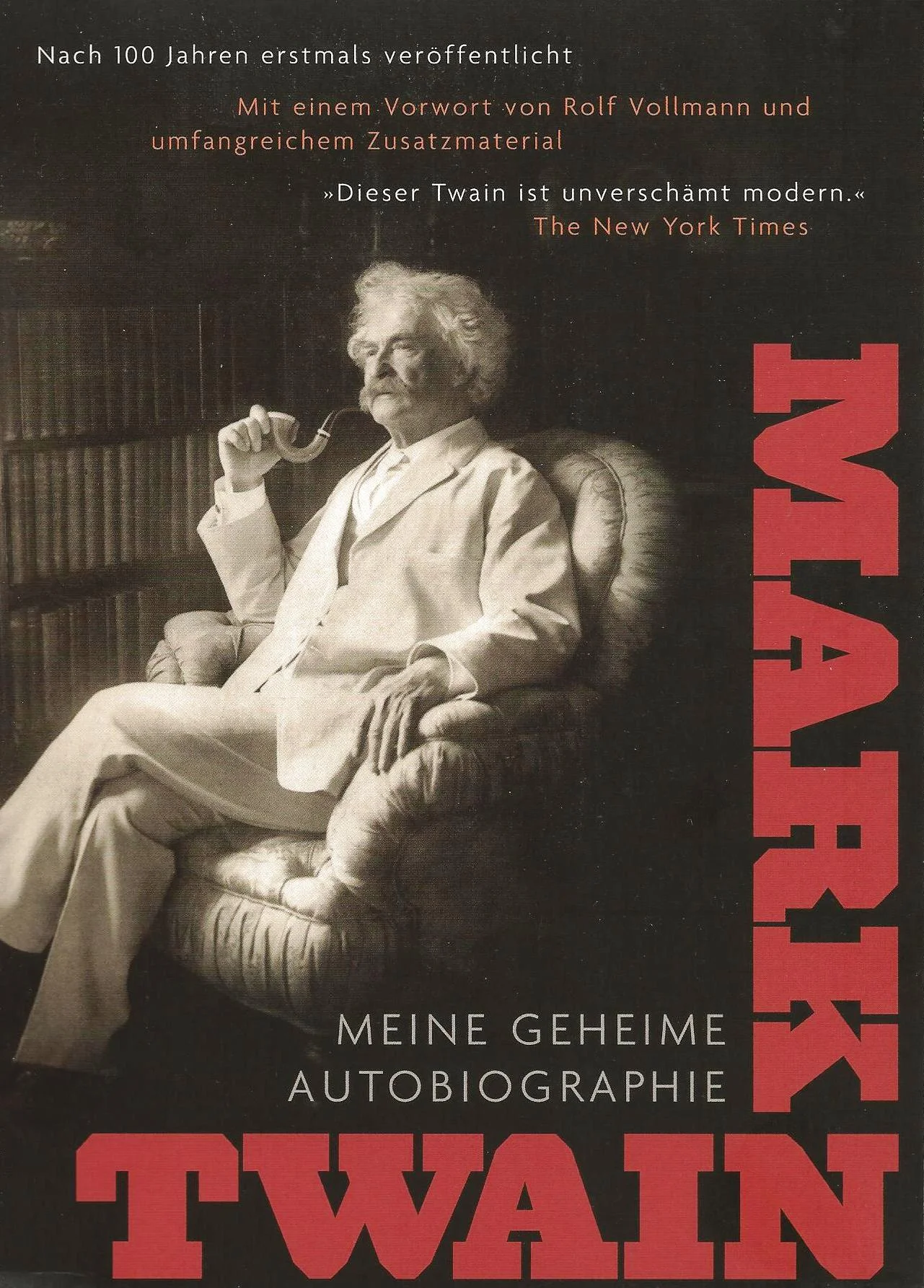Pointen sprudeln, eine Anekdote jagt die andere. Er zieht alle Register, er übertreibt, er fotzelt, er ist poetisch, zynisch - und er rechnet ab. Aber nur mit den Grossen. „Die Kleinen, die Gemeinen, die Unwürdigen brate ich nicht.“
Es ist kein geschriebenes Buch. Mark Twain schreibt nicht, er diktiert: Geschriebenes sei spröde. „Mit der Feder in der Hand ist das Erzählen eine schwierige Kunst. Eine Erzählung sollte fliessen, wie ein Bach durch Hügel und Laubwälder fliesst.“
So diktiert er, schwärmt, kommt auf Touren, schweift ab, verliert den Faden, findet zurück, plaudert drauf los, widerspricht sich selbst. Da stehen Sätze, wie: „Was ich sagen wollte, bevor ich mich selber unterbrach.“ Das gibt dem Stoff eine faszinierende Lebendigkeit. Er verfügt, dass seine Autobiographie erst hundert Jahre nach seinem Tod veröffentlicht wird. Denn nur so, wenn alle tot sind, könne er sich „ganz freimütig“ über sie äussern. Auf Englisch wurde dieser erste Band der Autobiographie vor zwei Jahren publiziert.
Die jetzt vorliegende deutsche Übersetzung ist eine Meisterleistung. Dem Übersetzer gelingt es, den „twainschen“ Sprachfluss in ein frisches, modernes Deutsch zu fassen.
Mit welchem sprachlichen Feuerwerk walzt da Mark Twain eine Gräfin nieder: eine Villen-Besitzerin in Florenz, „ein amerikanisches Produkt … mit dem Wohlgeruch presbyterianischer Frömmigkeit“. Über viele Seiten hinweg versprüht er Gift und Galle. „Ich hatte schon fast meinen Glauben an die Hölle verloren, bis ich Bekanntschaft mit der Gräfin Massiglia machte.“ Selten hat ein Autor mit einer solch herrlichen Virtuosität jemandem so sehnlich nahegelegt, sich „ins Jenseits zurückzuziehen“.
Nur wenige können mit der Sprache so spielen
Sein Humor ist fein und einmalig. Immer hantiert er mit Zwischentönen, mit Anspielungen, mit Untertönen. Er stichelt und spottet. Nur wenige können mit der Sprache so spielen wie er. Wie er doch Menschen charakterisieren kann; wie er ihnen auf die Füsse tritt, wie er sie seziert oder schmoren lässt – ein Schmaus. Und er hat die Grösse, über sich selbst zu lachen. Er beabsichtige, dass seine Autobiografie „viele Jahrhunderte lang gelesen und bewundert wird dank ihrer Form und ihrer Methode“.
Da schreibt er: Das Dorf in Missouri, in dem ich geboren wurde, „bestand aus hundert Einwohnern und ich vermehrte die Bevölkerung um 1 Prozent“.
Die Familie zog dann in Planwagen nach Hannibal am Mississippi. „Gegen Abend, als man ein Lager aufschlug und die Kinder zählte, fehlte eins. Das eine war ich. Ich war zurückgelassen worden. Eltern sollten ihre Kinder stets zählen…“
"Ich bin kopflos zur Welt gekommen"
Da heisst es auch: Seine Mutter „brachte zwei oder drei Neger in die Ehe, sonst nichts“. Oder: „Wo sein Herz hätte sitzen sollen, gähnte Leere.“ Oder: „Sein Hirn war die reinste Öllache.“ Oder: „Er sprach ein Französisch, das die Milch gerinnen lässt.“ Oder: „Tom Sawyer habe ich verhungern lassen, aber das geschah im Interesse der Kunst.“ Oder: „Ich war schon immer kopflos. Ich bin kopflos zur Welt gekommen.“ Er spricht von einem Bildhauer, dessen einziges Talent es war, hässliche Grabsteine zu behauen - „mit Engeln mit der Physiognomie von Preisboxern“.
Wunderbar wie er fast einen Tag lang durch „einen beträchtlichen Teil der Vereinigten Staaten“ einer Truthenne nachrennt, um sie zu fangen. Nach zehn Stunden machen er und die Henne eine Pause. „Ich tat so, als müsste ich etwas überdenken, und sie (die Henne) tat so, als müsste sie etwas anderes überdenken.“ Schliesslich verlor er den Kampf. Die Henne setzte sich auf einen Baum, schlug die Beine übereinander und blickte auf ihn hinunter.
Knallharter Gesellschaftskritiker
Doch Samuel Clemens (Künstlername Mark Twain) ist nicht nur der Humorist. Er ist ein knallharter Gesellschaftskritiker. Mit beissenden Worten entlarvt er die Heuchelei der Mächtigen und geisselt den Rassismus. Er verhöhnt den Militarismus und die amerikanischen Frömmler – und die katholische Kirche.
Er liebt die Schwarzen. „Alle Neger waren unsere Freunde.“ Er verehrt einen „treuen und liebevollen“ Sklaven. „Auf der Farm wuchs meine tiefe Zuneigung zu seiner Rasse.“ „Ein schwarzes Gesicht ist mir heute so willkommen wie damals.“ Auch den Antisemitismus – er hat ihn in Wien erlebt - prangert er an.
Ein Militarist ist er beileibe nicht. Zwar ist er während des amerikanischen Bürgerkrieges zwei Wochen lang in eine Südstaaten-Armee hineingerutscht, doch das war‘s dann. Wenn es sich um einen „ungerechten Krieg“ handelte, würde er sich weigern, „das Gewehr zu schultern“.
Die "christlichen Schlächter"
Er berichtet, wie amerikanische Soldaten auf den Philippinen 600 unbewaffnete Moros, auch Frauen und Kinder, hingemetzelt haben: diese Soldaten, „unsere uniformierten Meuchelmörder“, die ganz nach dem „Geschmack christlicher Schlächter“ handelten. Zynisch geht es weiter: „Das ist der weitaus grösste Sieg, den die christlichen Soldaten der Vereinigten Staaten je errungen haben.“
Ebenso zynisch: Die Amerikaner würden den Thanksgiving Day feiern, weil sie „allen Grund hatten dankbar zu sein“, dass „es ihnen gelungen war, … die Indianer auszurotten...“. Jetzt sind die Indianer „vollständig und zufriedenstellend ausgerottet“.
Zwar stammt Mark Twain aus einer republikanischen Familie, doch hält er wenig von Parteienzugehörigkeit. „Die Parteien sollten fast gleich stark sein, damit die Führer auf beiden Seiten die allerbesten Männer auswählen müssen.“ „Demokratische Väter sollten ihre Söhne zwischen den beiden Parteien aufteilen… um das Kräfteverhältnis auszugleichen.“ Dumm nur: „Ich habe nur einen Sohn.“
Mark Twain kriegt Krach mit dem republikanischen Klub, in dem er verkehrt, weil er sich anmasst, einen Demokraten zum Präsidenten wählen zu wollen. „Keine Partei hat das Recht, mir vorzuschreiben, wie ich wählen soll.“
Der Knabe vom Mississippi
Über Theodor Roosevelt, den „geschwätzigen“ Präsidenten, spottet er: „In unglaublicher Eile saust er von einer Sache zur andern, schlägt einen Purzelbaum und ist gleich darauf wieder dort, wo er in der Vorwoche war.“ So ähnlich lesen sich streckenweise auch Mark Twains Memoiren.
„Manchmal habe ich selbst das Verlangen gespürt, Seeräuber zu sein.“ Der Knabe vom Mississippi, der kaum zur Schule gegangen ist, war fast alles: Lotse, Schriftsetzer, Vagabund, Goldschürfer, Freimaurer (kurze Zeit), Soldat (zwei Wochen lang), Weltreisender, Abenteurer, Chefredaktor, Druckerei-Mitbesitzer, Reiseschriftsteller, Buchautor, Geschäftsmann, Unternehmer, Vortragsreisender, Verleger, Ehrendoktor. Er ist in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen und wird erst gegen Ende seines Lebens ein reicher Mann.
Jeder Kritiker schreibt nur dem andern ab
Scharfe Kritik übt er an den Kritikern: „Ich glaube, dass das Handwerk des Literatur-, Musik- und Theaterkritikers das nichtswürdigste aller Handwerke ist.“ Aber: „Lassen wir das. Es ist der Wille Gottes, dass wir Kritiker, Missionare, Kongressabgeordnete und Humoristen haben, und so müssen wir diese Last tragen.“
Ohnehin schreibe jeder Kritiker dem andern ab. Deshalb ist es wichtig, wer als erster eine Kritik verfasst. So gab er seine Bücher immer zuerst einem Freund, von dem er wusste, er würde eine gute Kritik schreiben. Die Kritiker-Schafe folgten dann – mit guten Kritiken.
Hemingway war von ihm begeistert: „Die ganze amerikanische Literatur stammt von einem Buch namens Huckleberry Finn ab. Vorher gab es nichts. Seitdem gab es nichts.“
In seiner Autobiographie erwähnt er auch kleine und kleinste Dinge. Denn: „Genau daraus besteht ein Menschenleben – aus kleinen Zwischenfällen und aus grossen Zwischenfällen.“ Sie haben „alle dieselbe Grösse. Eine Autobiographie, die die kleinen Dinge auslässt und nur die grossen aufzählt, ergibt kein richtiges Bild vom Leben des Betreffenden.“
Der Mensch, weniger Wert als Ratten
Den Menschen charakterisiert er wenig vorteilhaft. Von der ganzen Brut sei der Mensch „der Einzige, Alleinige, der Bosheit besitzt“. Deshalb sei er weniger Wert als „Ratten, Maden, Trichinen“. Er sei „das einzige Geschöpf, das Schmerz zum Zeitvertreib zufügt, in dem vollen Bewusstsein, dass es Schmerz ist“.
In seinen letzten Jahren macht sich ein pessimistisches Menschenbild breit: Die Menschen „ackern und rackern und ringen um ihr Brot; sie zanken und zettern und streiten, sie rangeln sich um kleine, schäbige Vorteile“. Dann beschleicht sie das Alter, Gebrechen folgen. “Schändlichkeiten und Demütigungen brechen ihren Stolz und ihre Eitelkeit… Lebensfreude verwandelt sich in kummervolles Leid … schliesslich ist aller Ehrgeiz erloschen, aller Stolz erloschen, alle Eitelkeit erloschen…“
Hervorragend ist seine Charakterisierung von Ulysses Grant, dem Helden des Bürgerkrieges und späteren Präsidenten. Mark Twain beschreibt ihn als verarmten, wirtschaftlich betrogenen, allzu gutmütigen Mann. Er erlebte seine letzten Tage.
Der Tod seiner Frau und seiner Tochter
Zu den ergreifendsten, herzzerreissendsten Passagen in der Autobiographie gehören die Texte über seine Frau Olivia Langdon und seine Tochter Susy.
Sie, Susy, stirbt mit 24 Jahren und fünf Monaten an einer Hirnhautentzündung. Ihr Tod stürzt ihn ins Elend. Er hat sie verehrt, vergöttert. In seiner Autobiographie zitiert er immer wieder Ausschnitte aus ihrer Biographie und kommentiert sie liebevoll. Sie war schön, liebevoll, geistreich, ihrer Zeit weit voraus. Sie stirbt, als er in Europa weilt.
Dann, ein zweiter Schicksalsschlag. Seine Frau Olivia stirbt mit 56 Jahren. Sie war mit 16 auf dem Eis gestürzt und teilweise gelähmt. Zeit ihres Lebens wurde sie nicht mehr wirklich gesund. Bis zu ihrem Tod konnte sie stets nur ein paar hundert Meter gehen, dann musste sie sich ausruhen.
Mark Twain beschreibt sie so liebevoll, wie wenige Schriftsteller ihre Frau beschrieben haben. „Sie war schlank, schön und mädchenhaft. Sie war beides, Mädchen und Frau.“ Beide verbrachten die letzten 22 Monate in Florenz, weil ihr der Arzt ein mildes Klima verordnete. Er beschreibt, wie ihr Tod „ihrem lieblichen Gesicht die entschwundene Jugend wiedergab“.
Wen würde Mark Twain heute wählen?
Mark Twains Ansichten sind „moderner“ als jene vieler heutiger Amerikaner. Er sieht die Frauen nicht am Herd, er ist gegen das Waffentragen, gegen unsinnige Einmischung in fremden Ländern, gegen die schleimige Frömmelei, gegen die masslose Gier nach Geld, gegen den Anspruch, dass eine politische Gruppe die Wahrheit gepachtet hat. Hätte er in den Fünfzigerjahren, in der McCarthy-Ära, gelebt, wäre er als schlimmer Kommunist verurteilt worden.
Wie würde sich Mark Twain heute verhalten? Er wäre sicher gegen den Krieg in Vietnam gewesen, auch gegen das Engagement im Irak und in Afghanistan. Er wäre wohl auch bei „Occupy Wallstreet“ mitmarschiert. Und er, der aus einem republikanischen Umfeld stammte, würde mit grosser Sicherheit bei den Präsidentschaftswahlen am 6. November einen schwarzen Demokraten wählen.
Mark Twain, Meine Geheime Autobiographie, Aufbau Verlag, Berlin, 1. Auflage, Oktober 2012, Übersetzung: Hans-Christian Oeser, ISBN 978-3-351-03513-6 -- 724 Seiten + Hintergründe und Zusätze 397 Seiten