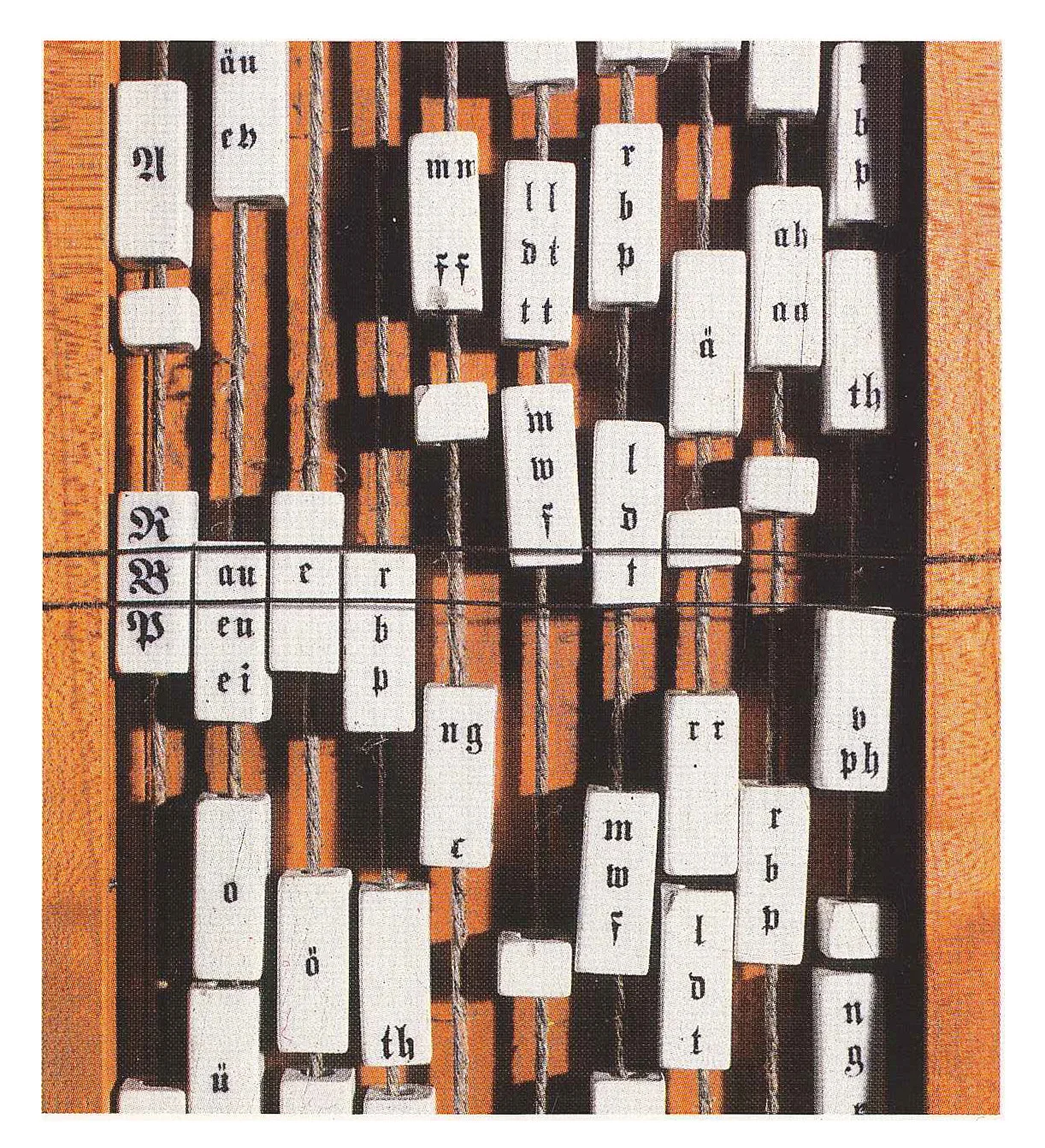
Es wird weniger gelesen. Die Lesekompetenz der Jugendlichen sinkt. Ein verdrängtes Faktum. Bildungspolitik und Schule müssten gegenhalten und diese Kulturtechnik fördern, wie dies schon einmal der Fall gewesen ist. Ein Blick zurück zeigt es.
Eine Kindheit als eigene Lebensphase und mit Schulzeit gab es lange nicht. Die Kinder werden als ökonomische Ressource schnell zu kleinen Erwachsenen. Früh treten sie in die handwerklich und landwirtschaftlich dominierte Arbeitswelt ein. Man braucht sie fürs Werken und Rackern auf Feld und Hof – und später in den Fabriken. Der Stall ist notgedrungen stärker als die Schiefertafel, das Brot wichtiger als ein Buch. «Lesen [ist darum] wahrlich ein selt’nes Glück», wie es der arme Mann aus dem Toggenburg, Ulrich Bräker, um 1775 ausdrückt.[1]
Unterricht aus dem Wirrwarr des Zufallslernen befreien
Viele Kinder bleiben Analphabeten; sie sind aufs Vorlesen oder bestenfalls auf gemeinsames Buchstabieren und Deuten eines Textes angewiesen. Eindrücklich schildert dies der Pädagoge und Sozialreformer Johann Heinrich Pestalozzi (1746–1827) im «Stanser Brief»: «Unter zehn Kindern, konnte kaum eins das A b c.» Und er fügt bei: «Von anderm Schulunterrichte […] war noch weniger die Rede.»[2]
Das will die neue helvetische Regierung um 1800 ändern. Sie möchte die Kinder aus den Arbeitswelten herausholen und ihren Schulunterricht aus dem Wirrwarr des Zufallslernens befreien. Die Helvetik (1798–1803) versteht sich als konsequente Antithese zum Ancien Régime. Sie realisiert Ideen der Aufklärung und nimmt mit dem bislang ungewohnten Gedanken der Gleichheit einen irreversiblen Mentalitätswandel vor: etwas völlig Neues, gar Radikales. Die patrizisch-aristokratische Oberschicht, das «Volk in Seide», wie Pestalozzi es formuliert, hat sich bis dahin kaum richtig bemüht, den gewöhnlichen Leuten, dem «Volk im Zwilch», zu politischer Gleichheit zu verhelfen. «Der gemeine Mann darf kein Gelehrter werden», so die Denkweise. Bildung bleibt darum ein Privileg weniger.
Kampf zwischen Idealität und Realität
Die helvetische Regierung versteht sich als eine Art Sarastro – und dieser Sarastro setzt sich zur Aufgabe, die Menschen zu bilden. Der Glaube, dass eben nur ein gebildetes Volk die Prinzipien der neuen Zeit anerkennen könne, gibt im neuen helvetischen Staat dem Auf- und Ausbau der Schulen höchste Priorität. Das Unterfangen ist dornig und der Pfad steinig, der pädagogische Wandel zäh und der Fortschritt ein hartnäckiger Kampf zwischen Utopie und Machbarkeit, zwischen Idealität und Realität. Er braucht Zeit und Energie.
Die Wirklichkeit im Schweizer Bildungswesen erfährt in Struktur und Programm nach und nach eine zeitgemässe Verbesserung. Die pädagogische «Frühlingssaat» der Helvetik und ihrer bahnbrechenden Schulpolitik geht langsam auf. Der neue Bundesstaat nach 1848 realisiert ideell und dann auch materiell-organisatorisch, was die Helvetische Republik erreichen wollte: eine umfassende Bildung und Erziehung als Fundament des demokratischen Staates. Die Kulturtechniken Lesen und Schreiben und ebenso Rechnen werden zum Allgemeingut. Ein zäher und langer Weg!
Lesekompetenz und Textverständnis schwinden
Die Lesekompetenz hat stetig zugenommen, speziell spürbar seit Ende des Zweiten Weltkrieges. In den Schulen wurde intensiv gelesen und geübt. Doch heute sinkt das Lesevermögen wieder – besonders einschneidend bei jenen Personen, die ab Ende der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts zur Welt gekommen sind. Die internationalen Vergleichsstudien wie PISA (Programme for International Student Assessment) oder PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) zeigen es: Die jüngere Generation hält weder bei der gelesenen Textmenge pro Zeiteinheit noch beim Textverständnis mit.[3] Lesefreude und Lesekompetenz schwinden.
Das gilt auch für die Schweiz; beim Lesen liegt sie heute unterhalb des OECD-Durchschnitts von 75 Ländern (4). Der Anteil schwacher Leserinnen und Leser steigt. Jeder vierte Schulabsolvent kann nach neun Schuljahren nicht richtig und verständig lesen, diagnostiziert die PISA-Studie von 2019. Er verharrt auf dem untersten Niveau von sechs Kompetenzstufen. Das heisst, er ist nicht imstande, einem einfachen Text alltagsrelevante Informationen zu entnehmen. Konkret: Ein Viertel vermag das Geschriebene zwar zu entziffern, versteht aber das Gelesene im Gesamtkontext nicht. Dabei wäre ein ausgeprägtes Leseverständnis elementar. Die sprachliche Heterogenität heutiger Klassen akzentuiert das Problem noch.[5]
Wenn Verstehen zur Schwerstarbeit wird
Das Kernproblem der mangelnden Lesekompetenz nicht weniger junger Menschen liegt beim Verstehen. Konzentrierte Lektüre wird seltener. Usanz ist heute das Lesen von WhatsApp-Nachrichten und von flüchtig gescannten Kurztexten. Das gehört zum Leben junger Leute. Der Lesemodus liegt im Überfliegen von Texten und im Gebrauch von Tablets oder Smartphones: Fast-Food-Information, in Sekundenhäppchen präsentiert und konsumiert. Wie soll man da Gedanken zu Nikolaus Kopernikus oder Charles Darwin verstehen? Dabei können Alerts die Lektüre jederzeit unterbrechen. Wer in den sozialen Netzwerken viele Freunde kennt, wird täglich von fünfzehnsekündigen Videoausschnitten förmlich überschwemmt. Mit Bildwelten aber kann sich kein Denken verbinden. Sie rauschen unkontrolliert oder unreflektiert an mir vorbei.
Dazu kommt, dass elektronische Geräte – anders als gedruckte Bücher – kaum materielle Orientierung im Text ermöglichen. Dies schmälert das kognitive Weiterkommen und führt zu Verstehens- wie auch zu Akzeptanzproblemen. Nicht-alltägliche Texte lesen und den Sinn verstehen wird so für manche Schülerinnen und Schüler zur Schwerstarbeit und die Aufgabe einer differenzierten Versprachlichung zur subjektiven Zumutung. Für die Lehrer bedeutet diese Unbehagens-Disposition der jungen Leute einen erheblichen Zuwachs an Anstrengung. Manche schauen weg und resignieren. «Was soll’s?». So öffnen sich neue Sprachbarrieren. Der Lesenotstand verschärft sich.
Lektürestunden in der jeder Schulart und in jedem Schulfach
Vertieftes und konzentriertes Lesen oder «deep reading»,[6] wie es die Leseforschung nennt, muss geduldig gelehrt, intensiv und auch gemeinsam geübt und reflektiert werden. Aus Sicht der Wissenschaft zuerst mit analogen und erst dann mit digitalen Medien. Dazu schreibt Klaus Zierer, Erziehungswissenschaftler und Ordinarius für Schulpädagogik an der Universität Augsburg: «Wir brauchen eine Renaissance der Lektüre, nicht als Beschäftigungstherapie vor den Ferien, nicht begleitend im Film, sondern im Kern des Curriculums, mit Lektürestunden in jeder Schulart und in jedem Schulfach.»[7]
Bedingung gesellschaftlicher Teilhabe
Nur ein gebildetes und lesefähiges Volk ist auch ein demokratiefähiges Volk! – Davon war die helvetische Regierung von 1798 zutiefst überzeugt. Sie förderte die Kulturtechnik des Lesens wie auch des Schreibens. Für den Einzelnen und die Gesellschaft. Was damals so wichtig war, gilt auch heute noch: Zur sozialen und politischen Teilhabe gehört eine angemessene Lesekompetenz. Nur informierte und unabhängige Bürgerinnen und Bürger interessieren sich für gesellschaftliche und demokratische Prozesse. Es ist kein Zufall, dass die Helvetik ein erster Schritt zur schweizerischen Demokratie wurde. Sie wusste: Die Förderung des demokratischen Lebens basiert auf der kollektiven Lesekompetenz.
Der Bildungspolitik und der Schule kommt darum eine hohe Verantwortung zu. Lesen darf nicht «zum selt’nen Glück» verkommen.
[1] Ulrich Bräker: Lebensgeschichte und natürliche Ebenteuer (sic) des armen Mannes im Tockenburg. In: Bräkers Werke in einem Band. Berlin und Weimar 1966, S. 83ff.
[2] Pestalozzi über seine Anstalt in Stans [kurz: «Stanser Brief» von 1799] (1997). Mit einer Interpretation und neuer Einleitung von Wolfgang Klafki. Weinheim und Basel: Beltz Verlag, S. 9.
[3] Klaus Zierer: Wir brauchen eine Renaissance der Lektüre. In: DIE ZEIT, 21.04.2022, S. 38.
(4) https://www.oecd.org/publications/pisa-2018-results-volume-i-5f07c754-en.htm
[5] Tanja Polli: Spricht hier jemand Deutsch? In: Beobachter 7/2023, S. 17–19. Jedes dritte Kind hat heute ein Sprachproblem, wenn es in den Kindergarten kommt.
[6] Häufig liest man auch den Ausdruck «higher-lever reading». Man möchte so das Idyll des kindlichen Lesens und die Assoziation mit dem vertrauten Buchgenuss vermeiden.
[7] Zierer, a. a. O.

